|
Teleskope
Archiv
- Juli 2002 - Dezember 2002
HUBBLE
 Galaxienentstehung
ganz nah Galaxienentstehung
ganz nah
Galaxien, so glaubten Astronomen bislang, bildeten sich vor relativ langer
Zeit oder aber bilden sich in recht großer Entfernung. Das Objekt POX 186,
das das Weltraumteleskop Hubble gründlich untersuchte, macht da
allerdings eine Ausnahme: Es ist uns relativ nah und erst 100 Millionen
Jahre alt. (27.
Dezember 2002)
VLT
 Erster
MIDI-Blick auf Epsilon Carinae Erster
MIDI-Blick auf Epsilon Carinae
Grund zu feiern gab es am 15. Dezember für ein Team von Astronomen und
Ingenieuren aus Deutschland, Holland, Frankreich und von der Europäischen
Südsternwarte ESO: Zum ersten Mal gelang es mit ihrem im Infraroten bei
Wellenlängen um 0,01 Millimeter empfindlichen Instrument MIDI die
Strahlengänge aus zwei der vier 8.2-Meter-Teleskope des Observatoriums auf
dem Cerro Paranal in den chilenischen Anden zusammenzuführen. (23.
Dezember 2002)
ELLIPTISCHE GALAXIEN
 Riesige
rotierende Gasscheibe entdeckt Riesige
rotierende Gasscheibe entdeckt
Amerikanische Astronomen haben die größte bislang entdeckte rotierende heiße
Gasscheibe aufgespürt: Sie hat einen Durchmesser von 90.000 Lichtjahren und
ist über acht Millionen Grad heiß. Der Fund könnte ein vollkommen neues
Licht auf die Entstehungsgeschichte von elliptischen Galaxien werfen. (20.
Dezember 2002)
CHANDRA
 Heißes
Gas überrascht Astronomen Heißes
Gas überrascht Astronomen
Eigentlich sollte sich das heiße Gas, das von einem kleinen Schwarzen Loch
ins All geschleudert wird, auf seinem Weg langsam abkühlen. Beobachtungen
des Röntgenobservatoriums Chandra zeigen aber nun, dass es auch
wieder aufgeheizt werden kann. Ursache dafür könnte ein kosmischer
Verkehrsstau sein. (17.
Dezember 2002)
HUBBLE
 Ein
Sextett aus vier Galaxien Ein
Sextett aus vier Galaxien
Im All liegen Zerstörung und Geburt dicht beieinander: So führen gewaltige
Galaxienkollisionen meist zu einer intensiven Phase von Sternentstehung. Im
Falle von Seyferts Sextett ist das hingegen anders. Beobachteten die
Astronomen also diese kosmische Massenkarambolage in einem sehr frühen
Stadium? (13.
Dezember 2002)
HUBBLE HERITAGE
 Zwei
Blasen und ein heißer Stern Zwei
Blasen und ein heißer Stern
Das Dezember-Bild des Hubble Heritage-Projekts blickt einmal wieder
in die Große Magellansche Wolke: Dort liegt der Reflexionsnebel N30B.
Astronomen machten sich dessen Eigenschaften zu Nutze, um mehr über den
hellen Stern Henize S22 zu erfahren, der auch auf dem Bild zu sehen ist. (6.
Dezember 2002)
VLT
 Wie
klein sind die kleinsten Sterne? Wie
klein sind die kleinsten Sterne?
Mit Hilfe des europäischen Very Large Telescope Interferometers (VLTI),
das Licht von zwei VLT-Teleskopen kombiniert, haben Astronomen nun die Größe
der kleinsten Sonnen in unserer Galaxis vermessen. Darunter befand sich auch
der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist: Proxima Centauri. (4.
Dezember 2002)
VLT
 Hot
Spots in 3C 445 Hot
Spots in 3C 445
Mit Hilfe des europäischen Very Large Telescope gelang Astronomen der
Blick in einen kosmischen Teilchenbeschleuniger. Er gehört zu einem
gewaltigen Strom aus Partikeln, der aus dem Kern der rund eine Milliarde
Lichtjahre entfernten Radiogalaxie 3C 445 ins All schießt. (26. November 2002)
CHANDRA
 Schwarze
Löcher im Doppelpack Schwarze
Löcher im Doppelpack
Zum ersten Mal haben Wissenschaftler im Zentrum einer einzigen Galaxie ein
Paar aktiver Schwarzer Löcher gefunden. Die Schwerkraftfallen im Herzen des
Sternsystems NGC 6240 werden in einigen hundert Millionen Jahren miteinander
verschmelzen und ein noch massereicheres Schwarzes Loch bilden - ein
Ereignis, das mit einem gewaltigen Ausbruch an Gravitationswellen
einhergehen sollte. (20. November 2002)
HUBBLE-HERITAGE
 Geisterhafter
Sternentod Geisterhafter
Sternentod
Das November-Bild des Hubble Heritage-Projekts zeigt wieder einmal
einen farbenprächtigen planetarischen Nebel und damit das eindrucksvolle
Ende eines Sterns, der einmal wie unsere Sonne geleuchtet haben könnte. NGC
6369 liegt in 2.000 bis 5.000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild
Schlangenträger und ist auch unter der Bezeichnung "Kleiner Gespenst-Nebel"
bekannt. (8. November 2002)
XMM-NEWTON
 Neutronensterne
bestehen wirklich aus Neutronen Neutronensterne
bestehen wirklich aus Neutronen
Wie sieht es im Inneren von Neutronensterne aus? Bestehen sie am Ende gar
aus einer exotischen Elementarteilchen-Suppe? Dank der Leistungsfähigkeit
des europäischen Röntgenteleskops XMM-Newton und durch Explosionen
auf der Oberfläche eines Neutronensterns gelang es Astronomen nun, Masse und
Radius eines solchen Objektes zu vermessen und dadurch erste Antworten zu
finden. (7. November 2002)
SURVEYS
 Sternenrelikt
aus der Frühzeit des Universums Sternenrelikt
aus der Frühzeit des Universums
Unter der Leitung von Astronomen der Hamburger Sternwarte gelang unlängst
ein spektakulärer Fund: Die Forscher spürten einen Stern auf, der kaum
schwere Elemente besitzt und damit aus einer Zeit stammen dürfte, in der
sich unsere Galaxie gerade bildete. Das Sternenrelikt stellt auch die
Theoretiker vor ein Problem: Nach ihren Modellen sollte es solche Sterne
eigentlich gar nicht geben. (31. Oktober 2002)
CHANDRA
 Dunkle
Materie ist real und kalt Dunkle
Materie ist real und kalt
Die meisten Astronomen glauben, dass sich die Bewegung von Sternen und
Galaxien nur erklären lässt, wenn man annimmt, dass der überwiegende Teil
der Materie nicht sichtbar ist und postulieren deswegen, die Existenz so
genannter Dunkelmaterie. Andere Forscher bevorzugten allerdings eine
abgewandelte Gravitationstheorie. Beobachtungen des Röntgenteleskops
Chandra erlauben nun erstmals beiden Theorien zu vergleichen: Dunkle
Materie scheint danach real zu sein. (23. Oktober 2002)
VERY LARGE TELESCOPE
 Rasender
Stern um das zentrale Schwarze Loch Rasender
Stern um das zentrale Schwarze Loch
Dass sich im Zentrum unserer Milchstraße ein Schwarzes Loch verbirgt,
vermuten die Astronomen schon seit längerer Zeit. Der überzeugendste Beweis
für diese These gelang einem Forscherteam nun mit Hilfe des Very Large
Telescope der Europäischen Südsternwarte: Sie beobachteten einen Stern,
der das galaktische Schwerkraftzentrum innerhalb von nur 15 Jahren umkreist
und sich ihm dabei bis auf 17 Lichtstunden annähert. (21. Oktober 2002)
VERY LARGE TELESCOPE
 Vier
Teleskope sehen mehr als eins Vier
Teleskope sehen mehr als eins
Astronomen reicht es schon lange nicht mehr nur immer größere Teleskope zu
bauen - man will die Instrumente am besten kombinieren, um so noch mehr
Details in den Weiten des Weltalls erkennen zu können. Bei der Kombination
der vier Einheiten des Very Large Telescopes der Europäischen
Südsternwarte ESO ist man unlängst einen entscheidenden Schritt
vorangekommen. (9. Oktober 2002)
HUBBLE HERITAGE
 So
nah und doch so fern So
nah und doch so fern
Sie erscheinen uns wie Nachbarn im All, sind aber in Wirklichkeit durch Raum
und Zeit getrennt: Das Oktober-Bild des Hubble Heritage-Projekts
zeigt die beiden Galaxien NGC 4319 und Markarian 205. Erstere ist 80
Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, Markarian 205 rund eine
Milliarde Lichtjahre. Die Nachbarschaft am Himmel ist also reiner Zufall. (4. Oktober 2002)
GALAKTISCHES ZENTRUM
 Infrarot-Blick
ins Herz der Milchstraße Infrarot-Blick
ins Herz der Milchstraße
Das Zentrum unserer Milchstraße fasziniert Öffentlichkeit und Astronomen
gleichermaßen, soll sich doch hier ein gewaltiges Schwarzes Loch verbergen.
Einem internationalen Forscherteam gelang nun ein detaillierter
Infrarot-Blick in diese Region. Zu sehen sind Staubschwaden, die
spiralförmig auf das Schwarze Loch zuströmen. (2. Oktober 2002)
CRAB-NEBEL
 Ein
Pulsar als Filmstar Ein
Pulsar als Filmstar
Über mehrere Monate hinweg beobachteten das NASA-Röntgenteleskops Chandra
und das Hubble-Weltraumteleskop immer wieder den Crab-Nebel samt des
rotierenden Neutronensterns in seinem Zentrum. Jetzt stellten die Astronomen
die einzelnen Beobachtungen zu einem faszinierenden Film zusammen und
erweckten so den fernen Pulsar zum Leben. (20.
September 2002)
HUBBLE
 Schwarze
Löcher in Kugelsternhaufen Schwarze
Löcher in Kugelsternhaufen
Mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops spürten zwei Astronomenteams
Schwarze Löcher mittlerer Größe im Zentrum zweier Kugelsternhaufen auf. Die
Entdeckung könnte ein wichtiger Mosaikstein sein, um zu verstehen, wie sich
die gewaltigen supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien
bilden. (18.
September 2002)
HUBBLE
 Detaillierter
Blick auf heißen Stern Detaillierter
Blick auf heißen Stern
Wie eine durch das All schwebende aufblühende Rose wirkt der Nebel N11A, der
auf einem jetzt veröffentlichten Bild des Hubble-Weltraumteleskops zu
sehen ist. Ursache für die eindrucksvolle Erscheinung ist ein massereicher
junger Stern, der sich im Inneren des Nebels verbirgt und diesen mit seiner
Strahlung zum Leuchten bringt. (13.
September 2002)
NGST
 Hubbles
Nachfolger heißt James Webb Hubbles
Nachfolger heißt James Webb
Gestern hat die NASA die kalifornische Firma TRW mit dem Bau des Nachfolgers
des Hubble-Weltraumteleskops beauftragt. Außerdem erhielt das bislang
als Next Generation Space Telescope bekannte Weltraumobservatorium
seinen endgültigen Namen: James Webb Space Telescope - benannt nach
dem zweiten Administrator der NASA. (11.
September 2002)
HUBBLE HERITAGE
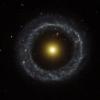 Das
Geheimnis von Hoags Objekt Das
Geheimnis von Hoags Objekt
Das September-Bild des Hubble Heritage-Projekts zeigt einen nahezu
perfekten Ring aus heißen, blauen Sternen um einen hell leuchtenden
Galaxienkern. Benannt wurde das rund 600 Millionen Lichtjahre entfernte
Objekt nach ihrem Entdecker: dem Astronomen Art Hoag. Es ist die
detaillierteste Aufnahme, die bislang von der Ringgalaxie gemacht wurde. (6.
September 2002)
HESS
 Blaue
Blitze aus dem Kosmos Blaue
Blitze aus dem Kosmos
In Namibia wird in der kommenden Woche das erste Teleskop des
Gamma-Experiments HESS eingeweiht. Nach Fertigstellung der gesamten Anlage
in zwei Jahren sollen insgesamt vier so genannte Tscherenkow-Teleskope mit
bisher unerreichter Empfindlichkeit Strahlung von fernen Galaxien oder
explodierten Sternen aufspüren. (30.
August 2002)
VLT
 Massereiche
Sterne entstehen überall Massereiche
Sterne entstehen überall
Massereiche Sterne spielen eine entscheidende Rolle bei der
Elemententstehung im Universum. Doch werden diese Sternenriesen auch überall
geboren, beispielsweise in den Zentren von Galaxien? Astronomen hatten daran
bislang ihre Zweifel. Neue Beobachtungen mit dem Very Large Telescope
(VLT) der Europäischen Südsternwarte zeigen aber jetzt erstmals, dass
massereiche Sterne offenbar überall entstehen können. (26.
August 2002)
STERNE
 Forscher
streiten um Quarksterne Forscher
streiten um Quarksterne
Beobachtungen mit dem US-Röntgenteleskops Chandra führten im April zu
einer sensationellen Entdeckung: Forscher glaubten zwei Sterne aus einer
neuen Form von Materie entdeckt zu haben. Nun haben Kollegen eins der
Objekte noch einmal genauer untersucht. Ihrer Ansicht nach handelt es sich
nicht um einen Quarkstern, sondern um einen ganz normalen Neutronenstern. (13.
August 2002)
VLT
 Abendstimmung
am Taruntius-Krater Abendstimmung
am Taruntius-Krater
33 Jahre nach der ersten Mondlandung gehen nun auch Astronomen des Very
Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternware von Chile aus auf
dem Mond spazieren: Die ESO veröffentlichte jetzt eine der wohl
detailliertesten Aufnahmen unseres Trabanten, die je von der Erde aus
gemacht wurde. Sie zeigt eine Region am Taruntius-Krater am späten
Nachmittag. (12.
August 2002)
LA SILLA
 Das
Portrait einer Galaxie Das
Portrait einer Galaxie
Eigentlich ist es nur ein Bild, doch für Astronomen ist die farbenprächtige
Aufnahme der nahen Galaxie NGC 300 eine wissenschaftliche Fundgrube, die von
den unterschiedlichsten Forschergruppen für ihre Untersuchungen genutzt
wird. Das macht auch die Bedeutung von großen Datenarchiven deutlich, durch
die einmal gemachte Beobachtungen allen Wissenschaftlern für eigene
Forschungen zur Verfügung stehen. (8.
August 2002)
BRAUNE ZWERGE
 Staubscheiben
sind eine Frage des Alters Staubscheiben
sind eine Frage des Alters
Erstmals konnten europäische Astronomen von der Erde aus Beobachtungen von
Braunen Zwergen im mittleren Infrarot-Bereich durchführen. Ziel war es, mehr
über den Entstehungsprozess dieser "verhinderten Sonnen" zu erfahren, die
nicht genügend Masse besitzen, um die nuklearen Fusionsprozesse im Inneren
zu starten. Die Daten deuten nun darauf hin, dass die Entstehung Brauner
Zwerge tatsächlich der von "richtigen" Sternen ähnelt. (5. August
2002)
HUBBLE HERITAGE
 Ein
intergalaktischer Hamburger Ein
intergalaktischer Hamburger
Beim Anblick des August-Bildes des Hubble Heritage-Projekts läuft
manchem Fast-Food-Fan sicherlich das Wasser im Mund zusammen: Doch was auf
den ersten Blick wie ein riesiger Burger aussieht, ist in Wirklichkeit ein
sonnenähnlicher Stern am Ende seines nuklearen Lebens. Bald wird die ferne
Sonne ein farbenprächtiger planetarischer Nebel sein. (2.
August 2002)
CHANDRA
 Dunkle
Gasschwaden im All entdeckt Dunkle
Gasschwaden im All entdeckt
Dank des NASA-Röntgenteleskops Chandra haben Astronomen ein
intergalaktisches Netz aus heißem Gas und dunkler Materie aufgespürt, bei
dem es sich vermutlich um den größten Teil der Materie im Universums handeln
dürfte. Solche Strukturen waren bislang nur vermutet aber noch nicht
beobachtet worden. (1.
August 2002)
CHANDRA
 Das
erste Röntgenbild vom roten Planeten Das
erste Röntgenbild vom roten Planeten
Auch unser Nachbarplanet Mars leuchtet schwach im Röntgenbereich. Das hat ein
Wissenschaftler des Garchinger Max-Planck-Instituts für extraterrestrische
Physik jetzt mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra nachweisen
können. Es ist nicht das einzige Objekt im Sonnensystem dessen
Röntgenstrahlung der Forscher entdeckt hat. (29.
Juli 2002)
CHANDRA
 Zwerggalaxien
als Sauerstoffquelle Zwerggalaxien
als Sauerstoffquelle
Mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra konnten amerikanische
Wissenschaftler beobachten, wie die nahe Zwerggalaxie NGC 1569 Sauerstoff
und andere schwere Elemente ins All bläst. Die Daten unterstützen nach
Ansicht der Forscher die These, dass Zwerggalaxien für den größten Teil der
schweren Elemente verantwortlich sind, die man im intergalaktischen Raum
zwischen den Galaxien findet. (24.
Juli 2002)
RADIOASTRONOMIE
 Der
schärfste Blick ins Weltall Der
schärfste Blick ins Weltall
Um immer mehr Details im All erkennen zu können, würde man immer größere
Teleskope benötigen. Radioastronomen schalten daher schon seit längerem
Antennen auf verschiedenen Kontinenten zusammen und erhalten so ein riesiges
virtuelles Radioteleskop. Wie leistungsfähig diese Technik ist, beweisen
unlängst veröffentlichte Beobachtungen: Sie stellen den bislang schärfsten
Blick ins Weltall dar. (23.
Juli 2002)
HUBBLE
 Ein
ungewöhnlicher planetarischer Nebel Ein
ungewöhnlicher planetarischer Nebel
Die ESA veröffentlichte gestern ein Bild des Hubble-Weltraumteleskops,
das einen äußerst ungewöhnlichen planetarischen Nebel zeigt. Der Nebel um
diesen im Sterben liegenden Stern ist extrem weit ausgedehnt. Astronomen
glauben, dass die Erforschung von planetarischen Nebeln auch zu wichtigen
Erkenntnissen über die Anreicherung der schweren Elemente im Universum
führen kann. (19.
Juli 2002)
ESO
 Auch
die Briten sind jetzt dabei Auch
die Briten sind jetzt dabei
Über zwei Jahre lang schien der Röntgenpulsar EXO 2030+375
inaktiv gewesen zu sein, doch in Wirklichkeit zeigte er heftige Aktivität.
Nur konnten die Forscher auf der Erde dies nicht erkennen, da die Signale
vom "Summen" eines Schwarzen Lochs in der Nähe überdeckt wurden. Dank einer
neuen Technik kamen sie dem Pulsar aber doch auf die Spur. (10.
Juli 2002)
XMM
 Mysteriöse
Eisenfabrik im All? Mysteriöse
Eisenfabrik im All?
Wie kommt das Eisen in die Welt? Nach Ansicht der Astronomen entstand es im
Inneren von Sternen und wurde dann während Supernova-Explosionen ins All
geblasen. Je älter das Universum ist, desto mehr Eisen sollte es also geben.
Deutschen Astronomen fanden jetzt aber einen Quasar, der drei Mal mehr Eisen
in sich birgt als unsere Sonne. Und den Quasar sehen wir in einer Zeit, in
der das Universum erst 1,5 Milliarden Jahre alt war. Gibt es also eine
"Eisenfabrik" im All? (9.
Juli 2002)
HUBBLE HERITAGE
 Farbenpracht
in Cassiopeia A Farbenpracht
in Cassiopeia A
Das Juli-Bild des Hubble Heritage-Projektes zeigt den jüngsten
Supernova-Überrest der Milchstraße, die Überbleibsel eines massereichen
Sterns, die unter dem Namen Cassiopeia A bekannt sind. Das Licht der
gewaltigen Explosion erreichte die Erde vor 320 Jahren. (4.
Juli 2002)
CHANDRA
 Seltene
Supernova in Whirlpool-Galaxie Seltene
Supernova in Whirlpool-Galaxie
Wissenschaftler haben mit Hilfe des NASA-Röntgenteleskops Chandra in
der Whirlpool-Galaxie das Röntgenlicht einer seltenen Supernova entdeckt.
Zusätzlich spürten die Forscher zahlreiche punktförmige Röntgenquellen auf,
bei denen es sich vermutlich um Neutronensterne und Schwarze Löcher in
Doppelsternsystemen handelt. (2. Juli 2002)
Ältere Meldungen aus dem
Bereich Teleskope finden Sie hier.
|
