|
Forschung
Archiv
- Juli 2006 bis Dezember 2006
 Suche
nach Exoplaneten beginnt Suche
nach Exoplaneten beginnt
Für die europäischen Planetenforscher begann mit dem gestrigen
erfolgreichen Start des COROT-Satelliten eine neue Etappe. Gestartet war die
Mission an Bord einer russischen Sojus-Fregat-Trägerrakete um 20.23
Uhr Ortszeit, also 15.23 Uhr MEZ, vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur.
Die europäische Satelliten-Mission soll nach extrasolaren Planeten suchen
und das Innere von Sternen erkunden. (28.
Dezember
2006)
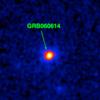 Zwei
Bursts passen nicht ins Bild Zwei
Bursts passen nicht ins Bild
Eigentlich dachten die Astronomen, sie wären endlich
hinter das Geheimnis der lange Zeit so mysteriösen Gammastrahlen-Ausbrüche
gekommen. Doch in der aktuellen Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift
Nature berichten Forscher von der Entdeckung zweier dieser
Gamma-Ray-Bursts, die entgegen der Erwartung nicht von einer
Supernova-Explosion begleitet wurden. Auch zwei deutsche Astronomen waren an
der Entdeckung beteiligt.
(22.
Dezember
2006)
 Intensive
Suche nach extrasolaren Planeten Intensive
Suche nach extrasolaren Planeten
Kurz vor dem Jahreswechsel soll es soweit sein: Mit dem
Start der Weltraum-Mission COROT wird erstmals von einer Erdumlaufbahn
systematisch nach extrasolaren Planeten gefahndet werden. Die beteiligten
Forscher aus ganz Europa hoffen auch auf die Entdeckung erdähnlicher Planeten. Dazu
sollen rund 60.000 Sterne beobachtet werden.
(13.
Dezember
2006)
 So
füttert man Schwarze Löcher So
füttert man Schwarze Löcher
Bei der Entstehung von Sternen und
Planetensystemen, aber auch bei der Bildung Schwarzer Löcher im Zentrum von
Galaxien, spielt ein außergewöhnlicher magnetischer Effekt eine
entscheidende Rolle: Erst durch ihn kann ein Schwarzes Loch überhaupt
wachsen. Im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf gelang nun erstmals der
experimentelle Nachweis dieses fundamentalen Effekts.
(3.
Dezember
2006)
 Suche
nach dem Echo kosmischer Kollisionen Suche
nach dem Echo kosmischer Kollisionen
Freude bei den deutschen Astronomen, die sich mit den bislang
unentdeckten Gravitationswellen beschäftigen: Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft hat einem deutschlandweiten Forschungsverbund sieben
Millionen Euro bewilligt, um auch in den nächsten Jahren nach diesen Echos
kosmischer Kollisionen zu fahnden. Eindrucksvolle Simulationen sind den
Wissenschaftlern schon gelungen.
(1.
Dezember
2006)
 Geschichte
des Universums in 52 Tagen Geschichte
des Universums in 52 Tagen
Wollte man die Simulation, mit der sich Potsdamer Astronomen derzeit
beschäftigen, auf einem heimischen Computer durchführen, müsste man über 100
Jahre auf ein Ergebnis warten. Glücklicherweise steht den Brandenburger
Forschern der leistungsfähigste Supercomputer Europas zur Verfügung. So
benötigen sie nur wenige Wochen, um neue Einblicke in die Entstehung und
Entwicklung des Universums und unserer lokalen Umgebung zu gewinnen.
(28.
November
2006)
MILCHSTRASSE
 Galaktische
Einflüsse auf das Erdklima Galaktische
Einflüsse auf das Erdklima
Auf ihrer Wanderung um das Milchstraßenzentrum durchquert
unser Sonnensystem immer wieder Spiralarme und ist dem Teilchenschauer
explodierender Sterne ausgesetzt. Nun fand der dänische Wissenschaftler Henrik
Svensmark vom Danish National Space Center in Kopenhagen Belege dafür,
dass diese wechselnden kosmischen Umweltbedingungen Auswirkung auf das irdische
Klima haben. (20.
November
2006)
PLANETENENTSTEHUNG
 Vom
Staubkorn zum Planeten Vom
Staubkorn zum Planeten
Wie wird aus winzigen Staubkörnern ein großer
erdähnlicher Planet? Mit dieser - angesichts zahlreicher neu entdeckter
Planetensysteme - äußerst aktuellen Frage will sich eine neu gegründete
Forschergruppe in vier deutschen Universitätsstädten näher beschäftigen. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft wird die Arbeiten in den nächsten drei
Jahren mit 1,5 Millionen Euro unterstützen. (8.
November
2006)
KUGELSTERNHAUFEN
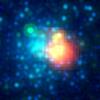 Die
Quelle des Sternenstaubs Die
Quelle des Sternenstaubs
Mithilfe des Spitzer-Weltraumteleskops fanden amerikanische
Astronomen eine bislang unbekannte aber sehr effektive Quelle kosmischen
Staubs: Im Kugelsternhaufen M15 entdeckten sie große Mengen dieses Stoffes,
der für unsere Existenz so entscheidend ist. Die Rolle von massearmen
Sternen bei der Produktion von Sternenstaub scheint somit bislang
unterschätzt worden zu sein. (6.
November
2006)
URKNALL
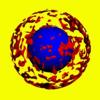 Sternentwickler
lösen Helium-Rätsel Sternentwickler
lösen Helium-Rätsel
Eigentlich sind Kosmologen mit der Urknall-Theorie ganz
zufrieden, wenn da nicht das Helium-Problem wäre: Von diesem Gas gibt es nämlich
deutlich weniger als nach Ansicht der Theoretiker vorhanden sein müsste. Jetzt
bieten Astronomen, die sich mit der Entwicklung von massereichen Sternen in
ihrer Riesenphase beschäftigen, eine Lösung für das Problem an.
(31.
Oktober
2006)
SETI
 Suche
nach Alien-TV Suche
nach Alien-TV
Moderne Radioteleskope, die eigentlich den Frühkosmos
erforschen sollen, könnten auch geeignet sein, um nach Spuren außerirdischer
Fernseh- und Radiosendungen zu suchen. Ein Radioteleskop, wie das in den
Niederlanden und Deutschland entstehende LOFAR, könnte so in einem Umkreis
von 1.000 Lichtjahren nach Spuren außerirdischer Intelligenz fahnden.
(26.
Oktober
2006)
 Computernutzer
sollen Planetenjägern helfen Computernutzer
sollen Planetenjägern helfen
Über 200 Planeten in fremden Sonnensystemen haben Astronomen bislang
entdeckt. Doch eine zweite Erde war nicht dabei, denn für eine solche
Entdeckung reicht die heutige Technik noch nicht aus. Um die Situation
außerhalb unseres eigenen Planetensystems besser zu verstehen, rufen deshalb
Astronomen die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf: In einer simulierten
"Galaxie" soll nach Planeten gefahndet werden.
(16.
Oktober 2006)
 Neutrinoexperiment
auf Europatour Neutrinoexperiment
auf Europatour
In Karlsruhe wird derzeit ein aufwendiges Experiment aufgebaut, mit dessen
Hilfe die Neutrinomasse mit bislang unerreichter Genauigkeit gemessen werden
soll. Eine Hauptkomponente der Anlage wurde im bayerischen Deggendorf
gebaut und trat nun ihre 8.800 Kilometer lange Reise nach Karlsruhe an.
(10.
Oktober 2006)
 Tiefer
Blick in Schwarze Löcher Tiefer
Blick in Schwarze Löcher
Mit dem japanischen Röntgensatellit Suzaku ist der
bislang tiefste Blick in die Umgebung supermassereicher Schwarzer Löcher
gelungen. Die Beobachtungen zeigen, wie die enorme Schwerkraft der Schwarzen
Löcher Raum und Zeit deformiert und sogar Röntgenstrahlung wieder einfängt.
(6.
Oktober 2006)
PHYSIK-NOBELPREIS
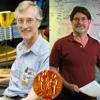 COBE
und die Hintergrundstrahlung COBE
und die Hintergrundstrahlung
Gestern gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften die Namen der
diesjährigen Physik-Nobelpreisträger bekannt: Mit John C. Mather und George
F. Smoot erhalten 2006 zwei Astrophysiker die wohl bedeutendste
wissenschaftliche Auszeichnung. Gewürdigt wird ihre Untersuchung der
kosmischen Hintergrundstrahlung mithilfe des COBE-Satelliten.
(4.
Oktober 2006)
NEUTRONENSTERNE
 Auf
der Spur der Hyperonen Auf
der Spur der Hyperonen
Neutronensterne gehören zu den wohl merkwürdigsten Objekten
im All: In einer Kugel mit nur einigen zehn Kilometern Durchmesser ist mehr als
die Masse unserer Sonne zusammengeballt. Über die genaue Zusammensetzung dieser
Sterne rätseln Physiker schon seit Jahren. Jetzt hoffen Wissenschaftler der
Universität Mainz, dass ein leistungsfähigerer Beschleuniger neue Einsichten in
das Innere von Neutronensternen liefert.
(2.
Oktober 2006)
STERNENTSTEHUNG
 Wie
große Sterne entstehen Wie
große Sterne entstehen
Radiobeobachtungen lieferten Astronomen nun neue Hinweise, wie massereiche
Sterne entstehen. Bislang rätselten die Wissenschaftler, wie diese
Sternenriesen trotz ihrer intensiven Strahlung überhaupt noch weiter wachsen
können. Um den jungen Stern G24 A1 entdeckten sie nun einen Ring aus Gas und
Staub. Ist dies die Erklärung?
(28.
September 2006)
KOSMOLOGIE
 Das
Universum - ein Ellipsoid? Das
Universum - ein Ellipsoid?
Eine Kugel, ein Ring oder gar ein vierdimensionaler Fußball?
Vorschläge für die Form des Universums gibt es viele. Eine Gruppe von
Physikern ist nun überzeugt, durch die Auswertung von Daten des Satelliten
WMAP Belege dafür gefunden zu haben, dass unser Kosmos ein Ellipsoid ist.
Schon eine leichte Abweichung von der Kugelform würde nämlich reichen, um
bislang unverstandene WMAP-Daten zu erklären.
(27.
September 2006)
SUPERNOVAE
 Eine
äußerst merkwürdige Sternenexplosion Eine
äußerst merkwürdige Sternenexplosion
Bestimmte Supernova-Explosionen dienen Astronomen als sogenannte
Standardkerzen, mit denen sie Entfernungen im Weltall relativ genau
ermitteln können. Das dachten sie zumindest: Jetzt lässt eine ungewöhnliche
Supernova bei Wissenschaftlern den Verdacht aufkommen, dass sich einige doch
anderes verhalten als angenommen.
(25.
September 2006)
RELATIVITÄTSTHEORIE
 Messungen
am Doppel-Pulsar Messungen
am Doppel-Pulsar
Wissenschaftler sind von Natur aus kritisch und so ist es nur zu
verständlich, dass zahlreiche Forschergruppen nach Möglichkeiten suchen, die
Vorhersagen von Einsteins Relativitätstheorie zu bestätigen oder aber
etwaige Widersprüche aufzudecken. Ein Doppel-Pulsar bot Astronomen nun genau
diese Möglichkeit: Messungen an dem System bestätigten jedoch die
Vorhersagen Einsteins mit einer Genauigkeit von 0,05 Prozent.
(15.
September 2006)
NEUTRINOS
 Jagd
nach verwandelten Neutrinos Jagd
nach verwandelten Neutrinos
Ein internationales Physiker-Team will erstmals die Umwandlung von Neutrinos
direkt nachweisen. In Rom fiel in dieser Woche der Startschuss zu einem
Experiment, bei dem ein Neutrinostrahl über 700 Kilometer durch die Erde
geschickt wird. Die Forscher hoffen, dass es auf dem Weg von Genf nach Rom zu sogenannten Neutrino-Oszillationen kommt.
(13.
September 2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Wasserplaneten
und "heiße Erden" Wasserplaneten
und "heiße Erden"
Amerikanische Forscher vermuten, dass sich in etwa einem
Drittel aller fremden Sonnensystemen mit massereichen Planeten auf engen
Umlaufbahnen auch erdähnliche Planeten in der bewohnbaren Zone befinden. Das
ergaben Simulationsrechnung zur Entstehung von Planetensystemen.
(12.
September 2006)
SUPERNOVAE
 Röntgenblitz
von Supernova Röntgenblitz
von Supernova
Astronomen haben erstmals einen Röntgenblitz beobachtet, der
bei der Supernova eines relativ massearmen Sterns aufflackerte. Bei dieser
Explosion kollabierte der Kern zu einem Neutronenstern. Bislang hatten
Astronomen angenommen, dass solche Blitze nur in Verbindung mit
Supernovae auftreten, bei denen besonders massereiche Sterne zu einem
Schwarzen Loch zusammenfallen.
(31.
August 2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Sonnensystem
mit Braunem Zwerg Sonnensystem
mit Braunem Zwerg
Astronomen der Universität in Jena haben einen Braunen Zwerg um einen Stern
entdeckt, der den Forschern schon länger als Zentralstern eines extrasolaren
Planetensystems bekannt war. Der Fund ist der bisher leuchtschwächste
Begleiter eines Planeten-Muttersterns, der direkt nachgewiesen wurde. (28.
August 2006)
FUSE
 Deuterium
bringt Theorien ins Wanken Deuterium
bringt Theorien ins Wanken
In unserer Milchstraße existiert erheblich mehr Deuterium als bislang von
den Astronomen vermutet. Das zeigen neue Beobachtungen mit dem
amerikanischen Satelliten FUSE. Die demnächst im Fachblatt Astrophysical
Journal veröffentlichten Messergebnisse könnten nach Ansicht der
Forscher eine radikale Erneuerung der Theorien über die Entstehung von
Sternen und Galaxien erfordern.
(15.
August 2006)
STERNE
 Magnetfelder
regeln Sternentstehung Magnetfelder
regeln Sternentstehung
Unser Sonnensystem entstand aus einer Gas- und Molekülwolke, die sich unter
ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzog. Mit den Details allerdings haben
Wissenschaftler ziemliche Probleme. Jüngste Beobachtungen spanischer und
amerikanischer Astronomen an einem System junger Sterne geben nun den
Theoretikern neue Hinweise, welche Prozesse die Sternentstehung
beeinflussen.
(11.
August 2006)
GALAXIEN
 Universum
größer als gedacht? Universum
größer als gedacht?
Lange Zeit war es still um die so genannte Hubble-Konstante,
also jene Zahl mit der man das Alter des Universums abschätzen kann. Nun
haben amerikanische Astronomen die Entfernung zur Galaxie M33 neu vermessen
und dabei festgestellt, dass sie 15 Prozent weiter von uns entfernt ist als
bislang gedacht. Somit könnte auch das Weltall größer und älter sein als
angenommen.
(8.
August 2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Die
Planemo-Zwillinge Die
Planemo-Zwillinge
Europäische Astronomen haben die Liste von extrasolaren
Planeten um zwei bemerkenswerte Exemplare ergänzt: Mit Hilfe von ESO-Teleskopen
konnten sie den ersten Doppel-Planemo nachweisen, also zwei
Objekte, die nur wenig größer sind als Jupiter, allerdings keine Sonne, sondern
sich selbst umkreisen. Der Fund liefert wichtige Hinweise auf die Entstehung der
Planemos.
(7.
August 2006)
GALAXIEN
 Einfache
Statistik, rätselhaftes Ergebnis Einfache
Statistik, rätselhaftes Ergebnis
Astronomen der University of California in Santa Cruz
haben eine an sich einfache Untersuchung gemacht: Sie zählten die Galaxien,
die sich in der Sichtlinie zu Quasaren und zu den Quellen sogenannter
Gamma-Ray-Bursts befanden. Das Ergebnis hat sie überrascht: In Richtung
der Burst-Quellen scheint es vier Mal mehr Galaxien zu geben. Jetzt
rätseln sie warum.
(3.
August 2006)
PULSARE
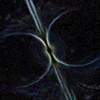 Neues
von alten Pulsaren Neues
von alten Pulsaren
Pulsare, also rotierende Neutronensterne, gleichen kosmischen Leuchtfeuern,
die über komplexe Prozesse elektromagnetische Strahlung erzeugen. Darüber,
wie sie eigentlich genau funktionieren, rätseln Astronomen seit der
Entdeckung dieser Objekte vor fast 40 Jahren. Dank der hohen Empfindlichkeit
des europäischen Röntgenobservatoriums XMM-Newton könnten Forscher
nun zumindest eine Teilantwort gefunden haben. (27.
Juli 2006)
SCHWARZE LÖCHER
 Dunkelmaterie-Blasen
in Galaxienzentren? Dunkelmaterie-Blasen
in Galaxienzentren?
Im Zentrum von Galaxien, so die Ansicht der meisten
Astronomen, verbergen sich supermassereiche Schwarze Löcher. Doch so sicher ist
dies nach Meinung eines amerikanischen Physikers nicht: Er schlägt nun, wie der
New Scientist in seiner neuen Ausgabe berichtet, Dunkelmaterie-Blasen als
Alternative vor. Damit dies funktioniert, müsste man allerdings die
Relativitätstheorie ein wenig modifizieren. (20.
Juli 2006)
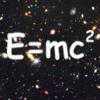 Forscher
auf den Spuren Albert Einsteins Forscher
auf den Spuren Albert Einsteins
In Berlin treffen sich in der nächsten Woche rund
1.000 Wissenschaftler, die sich mit Einsteins allgemeiner
Relativitätstheorie beschäftigen. Ziel dieser alle drei Jahre und erstmals
in Deutschland stattfindenden Marcel Grossmann-Treffen ist es, sich über
neueste Forschungen auszutauschen und über Experimente zu diskutieren, mit
denen die Gültigkeit von Einsteins Theorien getestet werden kann.
(17. Juli
2006)
 Drei
deutsche Unis und das dunkle Universum Drei
deutsche Unis und das dunkle Universum
Astronomen in Heidelberg,
Bonn und München wollen in den kommenden Jahren gemeinsam versuchen, hinter das
Geheimnis von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu kommen. Die Kooperation wird
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen eines so genannten transregionalen Sonderforschungsbereich mit dem Thema "Das Dunkle Universum"
unterstützt.
(11. Juli
2006)
Ältere Meldungen aus dem
Bereich Forschung finden Sie hier.
|
