|
Ferne Welten
Archiv - Januar 2006 bis Dezember 2006
 Suche
nach Exoplaneten beginnt Suche
nach Exoplaneten beginnt
Für die europäischen Planetenforscher begann mit dem gestrigen
erfolgreichen Start des COROT-Satelliten eine neue Etappe. Gestartet war die
Mission an Bord einer russischen Sojus-Fregat-Trägerrakete um 20.23
Uhr Ortszeit, also 15.23 Uhr MEZ, vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur.
Die europäische Satelliten-Mission soll nach extrasolaren Planeten suchen
und das Innere von Sternen erkunden. (28.
Dezember
2006)
PLANETENENTSTEHUNG
 Vom
Staubkorn zum Planeten Vom
Staubkorn zum Planeten
Wie wird aus winzigen Staubkörnern ein großer
erdähnlicher Planet? Mit dieser - angesichts zahlreicher neu entdeckter
Planetensysteme - äußerst aktuellen Frage will sich eine neu gegründete
Forschergruppe in vier deutschen Universitätsstädten näher beschäftigen. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft wird die Arbeiten in den nächsten drei
Jahren mit 1,5 Millionen Euro unterstützen. (8.
November
2006)
SETI
 Suche
nach Alien-TV Suche
nach Alien-TV
Moderne Radioteleskope, die eigentlich den Frühkosmos
erforschen sollen, könnten auch geeignet sein, um nach Spuren außerirdischer
Fernseh- und Radiosendungen zu suchen. Ein Radioteleskop, wie das in den
Niederlanden und Deutschland entstehende LOFAR, könnte so in einem Umkreis
von 1.000 Lichtjahren nach Spuren außerirdischer Intelligenz fahnden.
(26.
Oktober
2006)
 Computernutzer
sollen Planetenjägern helfen Computernutzer
sollen Planetenjägern helfen
Über 200 Planeten in fremden Sonnensystemen haben Astronomen bislang
entdeckt. Doch eine zweite Erde war nicht dabei, denn für eine solche
Entdeckung reicht die heutige Technik noch nicht aus. Um die Situation
außerhalb unseres eigenen Planetensystems besser zu verstehen, rufen deshalb
Astronomen die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf: In einer simulierten
"Galaxie" soll nach Planeten gefahndet werden.
(16.
Oktober 2006)
 Tag
und Nacht auf einer fernen Welt Tag
und Nacht auf einer fernen Welt
Das Weltraumteleskop Spitzer hat erstmals die Tages-
und Nachttemperaturen auf einem extrasolaren Planeten gemessen: Auf dem
Gasriesen, der seine Sonne in großer Nähe umrundet, herrschen auf der Tagseite
nahezu höllische Temperaturen, während es auf der Nachtseite eiskalt sein
dürfte. (13.
Oktober
2006)
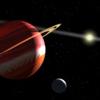 Der
Planet um Epsilon Eridani Der
Planet um Epsilon Eridani
Das Weltraumteleskop Hubble scheint Gefallen am Beobachten von
extrasolaren Planeten gefunden zu haben: Nach der Bekanntgabe der Entdeckung
von gleich 16 fernen Welten in der letzten Woche konnten Wissenschaftler nun
mit Hubbles Hilfe die Existenz des uns am nächsten gelegenen
extrasolaren Planeten um Epsilon Eridani bestätigen.
(10.
Oktober
2006)
 16
extrasolare Planeten entdeckt 16
extrasolare Planeten entdeckt
Bislang war das Weltraumteleskop Hubble nicht als
bedeutender extrasolarer Planetenjäger aufgefallen. Doch das hat sich nun
geändert: In der heutigen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Nature wird
die Entdeckung von insgesamt 16 extrasolaren Planeten bekannt gegeben, die im
Rahmen einer systematischen Durchmusterung mit Hubble entdeckt wurden. (5.
Oktober
2006)
 Zwei
heiße Exoplaneten Zwei
heiße Exoplaneten
Mit neuen Spezialteleskopen hat ein europäisches
Forscherteam zwei weitere Planeten bei anderen Sternen aufgespürt. Die
jupitergroßen Himmelskörper zählen zu den heißesten Exoplaneten, die bislang
entdeckt wurden. Die Planeten ziehen auf ihrer Bahn von der Erde aus gesehen
vor ihren Sternen vorüber und schwächen dabei das Sternenlicht leicht ab.
Die Astronomen berichteten gestern auf einer Fachtagung in Heidelberg über
ihren Fund.
(26.
September
2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Wasserplaneten
und "heiße Erden" Wasserplaneten
und "heiße Erden"
Amerikanische Forscher vermuten, dass sich in etwa einem
Drittel aller fremden Sonnensystemen mit massereichen Planeten auf engen
Umlaufbahnen auch erdähnliche Planeten in der bewohnbaren Zone befinden. Das
ergaben Simulationsrechnung zur Entstehung von Planetensystemen.
(12.
September 2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Sonnensystem
mit Braunem Zwerg Sonnensystem
mit Braunem Zwerg
Astronomen der Universität in Jena haben einen Braunen Zwerg um einen Stern
entdeckt, der den Forschern schon länger als Zentralstern eines extrasolaren
Planetensystems bekannt war. Der Fund ist der bisher leuchtschwächste
Begleiter eines Planeten-Muttersterns, der direkt nachgewiesen wurde. (28.
August 2006)
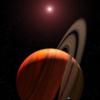 Hubble
entdeckt Mutterstern einer fernen Welt Hubble
entdeckt Mutterstern einer fernen Welt
Mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops ist es Astronomen
gelungen, den Mutterstern eines Planeten aufzuspüren, der im Jahr 2003 durch
die so genannte Microlensing-Methode entdeckt wurde. Zum ersten Mal
erfahren die Astronomen so mehr über einen Stern, dessen Planet sich
lediglich durch ein kurzes Flackern verraten hat.
(9.
August
2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Die
Planemo-Zwillinge Die
Planemo-Zwillinge
Europäische Astronomen haben die Liste von extrasolaren
Planeten um zwei bemerkenswerte Exemplare ergänzt: Mit Hilfe von ESO-Teleskopen
konnten sie den ersten Doppel-Planemo nachweisen, also zwei
Objekte, die nur wenig größer sind als Jupiter, allerdings keine Sonne, sondern
sich selbst umkreisen. Der Fund liefert wichtige Hinweise auf die Entstehung der
Planemos.
(7.
August 2006)
 Sonnenblende
macht Planeten sichtbar Sonnenblende
macht Planeten sichtbar
Bislang wurden zwar annährend 200 extrasolare Planeten
entdeckt, doch wie es auf den fernen Welten aussieht, bleibt Spekulation: Direkt
beobachtet wurden nämlich kaum einer der Exoplaneten. Amerikanische
Astronomen glauben nun, dass man mit einem Trick sogar Ozeane auf erdähnlichen
Planeten nachweisen könnte. Man würde nur eine riesige Sonnenblende benötigen.
(6.
Juli
2006)
 Die
Staubscheiben von Beta Pictoris Die
Staubscheiben von Beta Pictoris
Staubscheiben um junge Sterne sind inzwischen nichts besonderes mehr.
Doch ein neues Bild des Weltraumteleskops Hubble zeigt nun um den 63
Lichtjahre entfernten Stern Beta Pictoris gleich zwei Staubscheiben.
Die beste Erklärung für dieses Phänomen ist ein jupiterähnlicher Planet, der
den Stern in der Ebene der zweiten Scheibe umrundet.
(28.
Juni
2006)
 Haben
auch Planemos Planeten? Haben
auch Planemos Planeten?
Gleich zwei neue Untersuchungen haben gezeigt, dass auch
Objekte, die nur wenig größer sind als Jupiter, umgeben von einer Scheibe aus
Gas und Staub entstehen. Aus dem hier vorhandenen Material könnten sich also
ohne weiteres kleine Planeten bilden. Gibt es also auch um diese "Planemos"
winzige Planetensysteme?
(22.
Juni
2006)
 Kohlenstoff
im Überfluss Kohlenstoff
im Überfluss
Dass der junge Stern Beta Pictoris von einer
Staubscheibe umgeben ist, wissen Astronomen schon länger. Und auch Hinweise
auf Planeten um die 60 Lichtjahre entfernte Sonne wurden schon entdeckt.
Doch nun stießen Forscher auf eine Merkwürdigkeit: Die Staubscheibe enthält
doppelt so viel Kohlenstoff wie vermutet. Ist das Beta Pictoris-System damit
eine Ausnahme oder durchlief auch unser Sonnensystem eine kohlenstoffreiche
Periode?
(8.
Juni
2006)
 Drei
Planeten und ein Asteroidengürtel Drei
Planeten und ein Asteroidengürtel
Astronomen der Universität Genf und Astrophysiker der Universität
Bern haben ein Planetensystem aufgespürt, das etwas ganz Besonderes sein
könnte: Die Forscher entdeckten in dem rund 41 Lichtjahre entfernten System
gleich drei Planeten und einen Asteroidengürtel. Die Planeten sind teilweise
der Erde recht ähnlich und einer könnte sogar am Rand der lebensfreundlichen
Zone des Systems liegen. (19.
Mai
2006)
SPITZER
 Planetenentstehung
um Pulsar? Planetenentstehung
um Pulsar?
Das Infrarot-Weltraumteleskop Spitzer hat um einen Pulsar eine
Staubscheibe entdeckt, die aus den Trümmern eines explodierten Sterns
besteht. Die Astronomen halten es für möglich, dass in dieser Scheibe einmal
Planeten entstehen. Es ist das erste Mal, dass eine solche Scheibe um ein
Objekt entdeckt wurde, das durch eine Supernova-Explosion entstanden ist.
(7.
April 2006)
EXTRASOLARE PLANETEN
 Nur
ein Flackern verriet erdähnlichen Planeten Nur
ein Flackern verriet erdähnlichen Planeten
Eine Gruppe von Astronomen hat gestern die Entdeckung des kleinsten
bislang gefundenen extrasolaren Planeten bekannt gegeben. Die ferne Welt hat
etwa die 5,5-fache Masse der Erde und umrundet einen roten Zwergstern in
etwa der dreifachen Entfernung der Erde von der Sonne. Der Planet mit Namen
OGLE-20050BLG-390Lb ist eine eisige Welt: An seiner Oberfläche dürften
Temperaturen von minus 220 Grad herrschen.
(26.
Januar
2006)
Ältere Nachrichten über die
Suche nach extrasolaren Planeten und außerirdischem Leben finden Sie
hier.
|
