|
Noch heute Kryovulkanismus auf Ceres?
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung
astronews.com
10. März 2017
Schon beim Anflug der NASA-Sonde Dawn auf Ceres waren auf
Bildern eigentümlich helle Flecken auf der Oberfläche des Zwergplaneten zu
erkennen. Sie befinden sich im Zentrum des Occator-Kraters. Neue Untersuchungen
ergaben nun, dass diese Flecken wohl durch kryovulkanischer Aktivität entstanden
sind. Und diese könnte bis heute andauern.
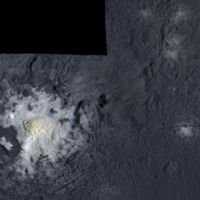
Falschfarben-Mosaik von Teilen des Occator-Kraters
aus Aufnahmen, die aus einem Abstand von 375
Kilometern entstanden.
Bild: NASA/JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR /
IDA [vergrößerte
Gesamtansicht] |
Seit fast zwei Jahren umkreist die NASA-Raumsonde Dawn den Zwergplaneten
Ceres, der innerhalb des Asteroidengürtels zwischen den Umlaufbahnen von Mars
und Jupiter seine Bahnen um die Sonne zieht. Zunächst drang die Sonde dabei nach
und nach in immer tiefere Umlaufbahnen vor, bis sie zwischen Dezember 2015 und
September 2016 nur noch etwa 375 Kilometer von der Oberfläche trennten. Aus
dieser Phase stammen die mit 35 Metern pro Pixel am höchsten aufgelösten
Aufnahmen der Dawn Framing Cameras, Dawns wissenschaftlichem
Kamerasystem, das unter Leitung des Max-Planck-Instituts für
Sonnensystemforschung (MPS) entwickelt und gebaut wurde und betrieben wird.
MPS-Forscher haben nun die komplexen geologischen Strukturen, die sich in den
Detailaufnahmen des Occator-Kraters zeigen, genau untersucht. Zu diesen
Strukturen zählen Risse, Gerölllawinen und später entstandene, kleinere Krater.
"In diesen Daten offenbart sich uns die Entstehungsgeschichte und Evolution des
heutigen Kraters so deutlich wie nie zuvor", so Andreas Nathues vom MPS,
wissenschaftlicher Leiter des Kamerateams. Zusätzliche Indizien lieferten die
ebenfalls ausgewerteten Messungen des Infrarotspektrometers VIR an Bord von
Dawn.
Der Occator-Krater auf der Nordhalbkugel von Ceres misst 92 Kilometer im
Durchmesser. In seinem Zentrum findet sich eine Senke mit einem Durchmesser von
etwa elf Kilometern, an deren Rändern stellenweise gezackte Berge und Steilhänge
emporragen. Noch weiter im Innern tritt eine helle domförmige Kuppe hervor: 400
Meter hoch, drei Kilometer im Durchmesser und durchzogen von Rissen. "Diese
Kuppe enthält das hellste Material auf Ceres", so MPS-Wissenschaftler Thomas
Platz. Forscher nennen das helle Material in der zentralen Senke Cerealia Facula.
VIR-Daten zeigen, dass es reich an bestimmten Salzen, sogenannten Karbonaten,
ist. Da spätere Einschläge kleinerer Brocken in diesem Bereich kein anderes
Material aus der Tiefe freilegten, ist es gut möglich, dass die Kuppe
vollständig aus hellem Material besteht. Die vereinzelten hellen Flecke (Vinalia
Faculae), die sich weiter außen im Kraterboden befinden, sind deutlich blasser,
bilden eine dünnere Schicht und entpuppen sich bei genauer Analyse der VIR- und
Kameradaten als Mischung aus Karbonaten und dunklem Umgebungsmaterial.
Nathues und sein Team deuten die zentrale Senke mit ihrem zum Teil bergigen,
zerklüfteten Rand als Überbleibsel eines früheren Zentralberges. Der Zentralberg
entstand als Folge des Einschlags, der den Occator Krater vor etwa 34 Millionen
Jahren schuf, und kollabierte später. Die Kuppe aus hellem Material ist mit 4
Millionen Jahren deutlich jünger.
Schlüssel zur Altersbestimmung war das genaue Zählen und Vermessen kleinerer
Krater, die durch spätere Einschläge entstanden. Grundannahme bei dieser Methode
ist, dass Oberflächen, die viele Krater aufweisen, älter sind als solche, die
weniger stark "durchlöchert" sind. Da in hochaufgelösten Aufnahmen auch recht
kleine Krater sichtbar werden, enthält die aktuelle Studie die bisher exakteste
Datierung dieser Oberflächen.
"Alter und Aussehen des Materials, das die helle Kuppe umgibt, deuten darauf
hin, dass sie durch einen wiederkehrenden, eruptiven Prozess entstanden ist, der
zum Teil auch Material nach weiter außen in die Senke geschleudert hat", so
Nathues. "Ein einzelnes eruptives Ereignis ist eher unwahrscheinlich", fügt er
hinzu. Für diese Theorie spricht auch ein Blick ins Jupitersystem. Auf den
Monden Callisto und Ganymed finden sich ähnliche Erhöhungen. Forscher werten
diese als Vulkankuppen und somit als Anzeichen von Kryovulkanismus.
Die MPS-Wissenschaftler gehen davon aus, dass auf Ceres ein ähnlicher Prozess
aktiv ist. "Der große Einschlag, der den riesigen Occator-Krater in die
Oberfläche des Zwergplaneten riss, muss alles ursprünglich in Gang gesetzt und
die spätere kryovulkanische Aktivität ausgelöst haben", so Nathues. Durch den
Einschlag konnte die Salzlösung, die Forscher entweder flächig oder vereinzelt
unter dem Gesteinsmantel des Zwergplaneten vermuten, näher an die Oberfläche
treten.
Der geringere Druck ließ Wasser und gelöste Gase wie Methan und Kohlendioxid
entweichen, die sich auf ihrem weiteren Weg nach oben ein System aus Schloten
bahnten. An der Oberfläche bildeten sich daraufhin Risse, durch die die
übersättigte Lösung eruptiv aus der Tiefe austreten konnte. Die abgelagerten
Salze formten nach und nach die heutige Kuppe. Der bisher letzte dieser
Ausbrüche muss vor vier Millionen Jahren die heutige Oberfläche der Kuppe
gestaltet haben.
Ob die kryovulkanische Aktivität seitdem vollständig zum Erliegen gekommen
ist oder auf einem geringeren Niveau bis heute fortdauern, ist unklar. Für
letzteres sprechen Aufnahmen des Kraters, die unter bestimmten Winkeln Dunst
zeigen. Bereits Ende 2015 hatten MPS-Forscher das Ausgasen von Wasserdampf für
dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Jüngste Untersuchungen bekräftigen nun
diesen Verdacht.
Die MPS-Forscher werteten dafür zahlreiche Aufnahmen des Occator-Kraters aus
einer frühen Phase der Mission aus, die aus einem Abstand von 14.000 Kilometern
und aus flachen Blickwinkeln entstanden. Deutlich zeigen sich darin
Helligkeitsschwankungen, die einem täglichen Rhythmus folgen. "Die Art der
Lichtstreuung über dem Boden des Occator Kraters unterscheidet sich grundlegend
von der über anderen Teilen der Ceres-Oberfläche", beschreibt MPS-Forscher
Guneshwar Singh Thangjam das Ergebnis seiner Analyse. "Die wahrscheinlichste
Erklärung ist, dass sich in der Nähe des Kraterbodens ein optisch dünner,
semitransparenter Dunst bildet." Die Forscher halten es für möglich, dass sich
der Dunst durch sublimierendes Wasser bildet, das bei Sonneneinstrahlung aus den
Rissen im Kraterboden austritt.
Die Ergebnisse wurden in zwei Fachartikeln in den Zeitschriften The
Astronomical Journal und The Astronomical Journal Letters
veröffentlicht.
|

