|
Blick auf Planet mit drei Sonnen
von Stefan Deiters
astronews.com
7. Juli 2016
Mithilfe des Very Large Telescope der europäischen
Südsternwarte ESO haben Astronomen einen extrasolaren Planeten direkt
beobachtet, der sich um eine Sonne eines Dreifachsternsystems bewegt. Solche Konfigurationen
gelten eigentlich als äußerst instabil. Auf der fernen Welt dürften
Dreifach-Sonnenaufgänge zu sehen sein, zuweilen scheinen die Sonnen aber auch Tag und
Nacht.

So könnte das ungewöhnliche System im
Sternbild Zentaur aussehen. Im Vordergrund der
Planet HD 131399Ab.
Bild: ESO/L. Calçada [Großansicht]
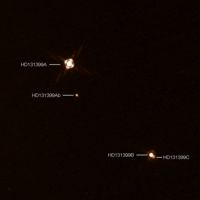
SPHERE-Aufnahme des Systems HD 131399.
Bild: ESO/K. Wagner et al.
[Großansicht] |
Bislang haben Astronomen nur äußerst wenige Planeten direkt beobachten
können. Das Licht der Zentralsterne in Planetensystemen überstrahlt einfach
meist die leuchtschwachen Welten. Mithilfe des Instruments SPHERE am Very
Large Telescope der ESO auf dem Gipfel des Paranal in Chile ist es einem Team um
Forschern der University of Arizona nun aber gelungen, einen Planeten in einem
äußerst ungewöhnlichen System direkt abzubilden.
Der Planet HD 131399Ab kreist um einen Stern eines Dreifachsystems, das etwa
320 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Zentaur liegt. Der Planet
umrundet die hellste der drei Sonnen in einem äußert großen Abstand. Solche
Konfigurationen sind oft sehr instabil, da ein Planet in einem solchen System
einem komplexen Wechselspiel von Anziehungskräften ausgesetzt ist. Planeten
auf stabilen Umlaufbahnen in Mehrfachsystemen gelten daher eigentlich als recht unwahrscheinlich.
Der jetzt entdeckte Planet HD 131399Ab ist ungefähr 16 Millionen Jahre alt
und dürfte etwa die vierfache Masse des Gasriesen Jupiter aufweisen. Mit einer
Temperatur von rund 580 Grad Celsius ist er zudem einer der kühlsten der bislang
direkt abgebildeten Planeten. "HD 131399Ab ist einer der wenigen extrasolaren
Planeten, die man direkt abbilden konnte und der erste in einer so interessanten
dynamischen Konfiguration", so Daniel Apai von der University of Arizona.
"Für etwa die Hälfte seines 550 Erdjahre dauernden Umlaufs sind drei Sonnen am
Himmel des Planeten zu sehen", erläutert Kevin Wagner, ein Doktorand an der
University of Arizona, die Besonderheiten des Systems. "Die
lichtschwächeren der Sonnen liegen am Himmel immer deutlich näher beieinander
und verändern ihren scheinbaren Abstand zur helleren Sonne im Laufe des Jahres."
Die meiste Zeit eines Jahres auf HD 131399Ab lassen sich somit Dreifach-Sonnenaufgänge und auch Dreifach-Sonnenuntergänge
beobachten. Allerdings entfernen sich die Sonnen im Laufe eines Jahres
immer weiter am Himmel voneinander. Für ein Viertel des Planetenjahres, also etwa 140 Erdjahre
lang, herrscht auf dem Planeten dadurch permanenter Sonnenschein -
wenn die eine Sonne untergeht, gehen die anderen beiden Sonnen gerade auf.
Um die genaue Konfiguration des Systems herauszufinden, sind noch weitere
Beobachtungen über einen längeren Zeitraum nötig. Bislang stellt sich das System den Astronomen aber so dar:
Der Stern HD 131399A hat etwa 80 Prozent der Masse unserer Sonne. Dieser Stern
wird in einem Abstand von 300 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische
Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne, also rund 150
Millionen Kilometer) von zwei sich umkreisenden masseärmeren Sternen umrundet,
die einen Abstand von etwa zehn Astronomischen Einheiten voneinander haben. Dies
entspricht etwa dem Abstand des Saturn von der Sonne. Der Planet HD 131399Ab
kreist in diesem Szenario in einem Abstand von etwa 80 Astronomischen Einheiten
um HD 131399A.
Sicher sind sich die Astronomen allerdings noch nicht, ob diese Konfiguration
stimmt. Es lassen sich daher auch noch keine abschließenden Angaben über die
Stabilität des Orbits von HD 131399Ab machen. Hier müssen erst weitere Beobachtungen
zusätzliche Daten liefern. "Wenn der Planet weiter von dem massereichsten Stern
entfernt wäre, würde er aus dem System gekickt", so Apai. "Unsere
Computersimulationen zeigen, dass dieser Orbit jedoch stabil sein kann, wenn man
aber die Dinge nur ein wenig ändert, kann das System sehr schnell instabil
werden."
Mehrfachsternsysteme sind in unserer Milchstraße eher die Regel als die
Ausnahme. Von daher sind Daten darüber, ob und wie Planeten auf stabilen
Umlaufbahnen in solchen Systemen entstehen können, für die Astronomen von großem
Interesse.
"Es ist noch unklar, wie der Planet auf seinen so weiten Orbit in diesem
ungewöhnlichen System gelangt ist", erläutert Wagner. "Wir können auch noch
nicht sagen, was dies für unser allgemeineres Verständnis solcher
Planetensysteme bedeutet. Es zeigt aber, dass es da draußen eine viel größere
Vielfalt gibt, als manche geglaubt haben. Planeten in Mehrfachsystemen wurden
bislang nur selten untersucht. Dabei könnten sie vielleicht genau so zahlreich
sein, wie Planeten in Systemen mit nur einem Stern."
Über ihre Beobachtungen berichten die Astronomen in einem Fachartikel der
heute online in der Zeitschrift Science erschienen ist.
|

