|
Wie sich Staubscheiben um junge Sterne auflösen
Redaktion
/ Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie
astronews.com
10. November 2021
Forschende haben einen Mechanismus identifiziert, der die
Eigenschaften von Staubscheiben um junge Sterne erklären kann, die sich gerade
auflösen. Die wichtigste Komponenten des physikalischen Konzepts sind
Röntgenemissionen des Zentralsterns und eine ruhige innere Scheibe, die von der
einfallenden Strahlung abgeschirmt ist.
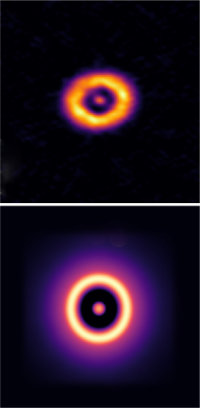
Vergleich zwischen beobachteten (oben) und
simulierten Staubverteilungen in
Übergangsscheiben.
Bild: Pinilla et al. / Gárate et al. /
MPIA [Großansicht] |
Planeten bilden sich in Scheiben aus Gas und Staub. Jede dieser Scheiben hat
zuvor bereits einen neuen Stern hervorgebracht, oder vielmehr einen sogenannten
Protostern, der sein Kernfusionsfeuer erst noch entfachen muss. Wenn wir jedoch
das Sonnensystem betrachten, stellen wir fest, dass der größte Teil dieses
Materials längst verschwunden ist. In den letzten Jahren hat die Forschung ein
grundlegendes Verständnis dafür erlangt, wie diese zirkumstellaren Scheiben ihre
Gas- und Staubreste verlieren.
Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Teleskope haben Astronominnen und
Astronomen diese sich auflösenden Scheiben, die sogenannten Übergangsscheiben,
sogar identifiziert und untersucht. Die Erforschung der detaillierten
physikalischen Prozesse blieb jedoch relativ erfolglos. Die theoretischen
Konzepte, die die Forschenden bisher entwickelt haben, konnten jeweils nur
einige der beobachteten Eigenschaften wiedergeben. Nun schlägt eine
Forschungsgruppe unter Leitung von Astronominnen und Astronomen des
Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) in Heidelberg ein neues Schema vor,
das die meisten Nachteile der bisherigen Ansätze überwindet. "Frühere Modelle
konnten nur einen Teil der Beobachtungsergebnisse von Übergangsscheiben
reproduzieren", sagt Matías Gárate vom MPIA. "Jetzt können wir jedoch die
meisten Eigenschaften erklären, die sich bisher zu widersprechen schienen: eine
große Lücke in der Scheibe und eine anhaltende Akkretion von Gas und Staub aus
einer langlebigen inneren Scheibe auf den Zentralstern."
Intuitiv ist es schwer zu verstehen, warum fast alle beobachteten
Übergangsscheiben mit einer großen Lücke Anzeichen von Akkretion aufweisen.
Akkretion ist der Prozess, durch den der Zentralstern mit Gas und Staub aus der
zirkumstellaren Scheibe gespeist wird. Bevor sich die Lücke öffnet, füllt
Material aus der dickeren äußeren Scheibe die inneren Bereiche auf und
unterstützt so den nachfolgenden Transport zum Zentralstern. Das Reservoir ist
jedoch begrenzt, so dass der Materiestrom mit der Zeit abnimmt. Gleichzeitig
trifft die Röntgenstrahlung des Sterns auf die Scheibenoberfläche und heizt sie
auf. Dadurch entsteht ein Wind, der das nun ionisierte Gas in den freien Raum
treibt. Dieser Prozess wird als Photoevaporation (etwa: Verdampfung durch Licht)
bezeichnet. Sobald er effizienter ist als der Materiestrom in der Scheibe von
außen nach innen, beginnt sich eine Lücke zu öffnen, die die innere Scheibe vom
äußeren Reservoir abtrennt. Danach sollte sich die innere Scheibe durch
Akkretion sehr schnell entleeren und rasch auflösen. Die Akkretion auf den Stern
kommt zum Stillstand.
"Um die Lebensdauer der inneren Scheibe zu verlängern und die
Akkretionsaktivität aufrechtzuerhalten, mussten wir einen Mechanismus finden,
der die Drift von Gas und Staub nach innen verringert", erklärt Paola Pinilla,
Leiterin der Forschungsgruppe "Genesis of Planets" am MPIA. "Eine Möglichkeit
besteht darin, eine allgemein akzeptierte Komponente zirkumstellarer Scheiben
mit einzubeziehen: eine sogenannte Totzone", ergänzt Timmy Delage, Doktorand am
MPIA. Eine Totzone ist ein relativ ruhiger, ringförmiger Bereich einer
zirkumstellaren Scheibe, in dem die zufällige Gasbewegung im Vergleich zu
anderen Scheibenbestandteilen vermindert ist. Infolgedessen wird die Reibung
zwischen den einzelnen Teilchen nahezu vernachlässigbar, so dass sie nur schwer
ihre Umlaufgeschwindigkeiten verringern können, was ihre Bahnen stabilisiert.
Totzonen können entstehen, wenn das Gas nur wenig ionisiert ist und von
Magnetfeldern gering beeinflusst wird. Sie können zum Beispiel auftreten, wenn
das Gas dicht genug ist, um die tieferen Scheibenschichten vor der Ionisierung
durch die auf die Scheibe treffende Strahlung zu schützen.
Um zu überprüfen, ob eine solche Totzone die beobachteten Ergebnisse von
akkretierenden Übergangsscheiben mit großen Lücken erklären kann, simulierten
Gárate und das Team deren zeitliche Entwicklung. Sie konstruierten ein
physikalisches Scheibenmodell, wobei sie die Anfangsbedingungen für die Totzone
variierten und Röntgenstrahlung einbezogen, um die Photoevaporation zu
ermöglichen. "Wir waren begeistert, als wir die Ergebnisse sahen. Eine große
Mehrheit der simulierten Übergangsscheiben mit einer Vielzahl von Lückengrößen
behielt einen nachweisbaren Akkretionsfluss zum zentralen sonnenähnlichen Stern
bei", berichtet Gárate.
Dieses Ergebnis zeigt, dass Totzonen in großer Zahl akkretierende
Übergangsscheiben mit großen Lücken erzeugen können. Sicherlich stellt das
Ergebnis einen deutlichen Sprung im Verständnis dessen dar, was Astronominnen
und Astronomen mit Teleskopen finden, wenn sie tatsächliche Übergangsscheiben
beobachten. Die Untersuchung reicht allerdings offenbar noch nicht aus, um die
genauen Zahlen abzubilden. Während durch Beobachtungen etwa drei Prozent der
Übergangsscheiben als nicht-akkretierend eingestuft werden, ergeben die
Simulationen mehr als das Zehnfache dieses Anteils.
Da die Rechenleistung begrenzt ist, spiegelt das in dieser Studie verwendete
Modell nur eine vereinfachte Version der realen Welt wider und umfasst nicht
alle möglichen Mechanismen, die in solchen Scheiben auftreten können. Einige von
ihnen könnten sogar die Lebensdauer der inneren Scheibe erhöhen. Andererseits
ist es gut möglich, dass einige der Schlussfolgerungen aus Beobachtungen
überdacht werden müssen, und dass es tatsächlich mehr nicht-akkretierende
Scheiben gibt als bisher angenommen.
In ihrer Studie untersuchte das vom MPIA geleitete Team die
Akkretionstätigkeit, indem es sich auf das Gas konzentrierte. Doch der Staub
kann sich ganz anders verhalten. Wenn Astronominnen und Astronomen Bilder von
solchen planetenbildenden Scheiben machen, sehen sie oft die Verteilung des
Staubs, der bei Millimeterwellenlängen strahlt und häufig die Form von
konzentrischen Ringen hat. Daher untersuchte das Team, ob ihre Simulationen auch
den Staub realistisch behandeln. "Um unsere Berechnungen mit hochaufgelösten
Bildern von realen Übergangsscheiben zu vergleichen, die wir mit dem
ALMA-Interferometer erhalten hatten, haben wir ein synthetisches Bild einer der
simulierten Staubscheiben erstellt", sagt Mitautor Jochen Stadler, Masterstudent
am MPIA und an der Universität Heidelberg.
Das Ergebnis ist eine verblüffende Bestätigung. Das Bild der
computergenerierten Staubverteilung zeigt die für Übergangsscheiben typischen
Elemente: eine kleine innere Scheibe und einen äußeren Ring, beide durch eine
große Lücke getrennt. Wie so oft, steckt der Teufel im Detail. Während die
Strukturen gut übereinzustimmen scheinen, weichen die Helligkeiten voneinander
ab. Die Staubemission der simulierten Übergangsscheiben ist wesentlich
schwächer, als man aufgrund von Beobachtungen erwarten würde. Daher besitzen die
synthetischen Scheiben wahrscheinlich weniger Staub als die realen Scheiben.
Die Autoren haben jedoch eine plausible Lösung für diese Unstimmigkeit. "Wir
denken, dass dies eine Folge der Planetenbildung ist, die wir in unseren
Modellen nicht berücksichtigt haben", so Gárate. Studien zeigen häufig, dass neu
entstandene Planeten auf ihren Bahnen Lücken in die Scheibe graben. Solche
Rillen wirken wie Barrieren für den radial driftenden Staub. Gárate fügt hinzu:
"Es ist gut möglich, dass die planetarischen Lücken aufgrund der unzureichenden
räumlichen Auflösung in den Beobachtungen nicht sichtbar sind. Wenn sich in der
inneren Scheibe Planeten bilden, könnte dies dazu beitragen, dass der Staub
nicht zum Zentralstern wandert. Wir werden unsere Modelle entsprechend erweitern
und untersuchen, ob wir auch dieses Rätsel lösen können."
Über die Studie berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der
Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.
|

