|
Kometenkollisionen um Beta Pictoris?
von Stefan Deiters
astronews.com
7. März 2014
Mithilfe des Radioteleskopverbunds ALMA haben Astronomen
einen Klumpen aus Kohlenmonoxidgas in der Staubscheibe um den Stern
Beta Pictoris entdeckt. Da dieses Gas sehr schnell von der Strahlung des Sterns
zerstört werden sollte, muss es durch irgendeinen Prozess ständig neu erzeugt
werden. Könnten kollidierende Kometen dafür verantwortlich sein?
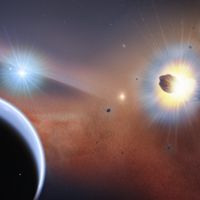
Kommt es um Beta
Pictoris zu Kollisionen von Kometen?Bild: NASA
Goddard Space Flight Center / F. Reddy |
Beta Pictoris ist für Astronomen kein Unbekannter: Der
nahegelegene helle Stern, der sich problemlos bereits mit bloßem Auge beobachten
lässt, ist von einer Scheibe aus Staub und Trümmerteilen umgeben und gilt als
Prototyp eines jungen Planetensystems. Er war einer der ersten Sterne, bei dem
eine solche Scheibe beobachtet wurde. Inzwischen hat man auch einen Planeten
entdeckt, der in einem Abstand von rund 1,2 Milliarden Kilometern um den
Zentralstern kreist.
Durch Beobachtungen mit dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array
(ALMA), einem Radioteleskopverbund in der chilenischen Atacama-Wüste, haben
Astronomen nun Kohlenmonoxidgas in der Staubscheibe um den Stern nachweisen
können. Erwartet hatten sie dieses Gas dort nicht: Es sollte nämlich durch die Strahlung
des Sterns sehr
schnell vernichtet werden und kann an der Stelle, wo es aufgespürt wurde, maximal 100 Jahre existieren - für Astronomen ist das lediglich ein
Wimpernschlag. Die Entdeckung des Gases in der rund 20 Millionen Jahre alten
Staubscheibe um den Stern war für die Astronomen also eine große Überraschung.
"Wenn wir Beta Pictoris nicht gerade zu einem sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt
beobachten, muss das Kohlemonoxid irgendwie beständig wieder aufgefrischt
werden", erläutert Bill Dent von der ESO, der Erstautor eines Fachartikels über
die Entdeckung, der gestern in der Wissenschaftszeitschrift Science erschienen
ist. "Die beste Quelle für Kohlenmonoxid in jungen Sternsystemen ist die
Kollision von eisigen Objekten, von Kometen bis zu Objekten von Planetengröße."
Die Kollisionsrate muss allerdings extrem hoch sein: "Um die
Kohlenmonoxidmenge erklären zu können, die wir beobachten, würde man die
Kollision eines großen Kometen alle fünf Minuten benötigen", schätzt Aki Roberge
vom Goddard Space Flight Center der NASA. "Für diese hohe Anzahl von Kollisionen
muss es sich um eine sehr dichte Wolke aus Kometen handeln."
Die ALMA-Beobachtungen ergaben aber noch eine weitere Überraschung: Die
Astronomen konnten nämlich auch den genauen Ort des Kohlenmonoxidgases in der
Scheibe bestimmen. Es befindet sich in einem einzelnen kompakten Klumpen in
einer Entfernung von rund 13 Milliarden Kilometern von Beta Pictoris. In unserem
Sonnensystem entspricht dies etwa der dreifachen Entfernung des Neptun von der
Sonne. Warum sich das Gas in diesem kleinen Klumpen sammelt, ist den Astronomen
noch ein Rätsel.
"Dieser Klumpen ist ein wichtiger Hinweis darauf, was in den äußeren
Bereichen eines jungen Sonnensystems vor sich geht", so Mark Wyatt von der
University of Cambridge in England. Der Astronom hält gegenwärtig zwei
Szenarien für denkbar, die die Beobachtungen erklären würden: "Entweder gibt es
dort einen bislang unentdeckten Planeten, der etwa die Masse des Saturn hat
und die Kometenkollisionen auf diesen Bereich begrenzt oder wir haben hier die
Reste einer gewaltigen Kollision zweier eisiger Planeten von der Größe des Mars
vor uns."
Beide Erklärungen würden auf die Entdeckung weiterer Planeten um Beta Pictoris hoffen
lassen. "Kohlenmonoxid ist erst der Anfang - es könnte noch komplexere Vorstufen
von organischen Verbindungen geben, die aus diesen eisigen Objekten freigeworden
sind", so Roberge. Die Astronomen hoffen nun, dass weitere Beobachtungen mit
ALMA noch zusätzliche Erkenntnisse liefern werden. Die ersten Beobachtungen
wurden gemacht, bevor der Teleskopverbund seine volle Ausbaustufe erreicht
hatte.
|

