|
Erneuertes ALICE-Experiment nimmt Testbetrieb auf
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung der Goethe-Universität Frankfurt am Main
astronews.com
7. Dezember 2022
Mit dem Experiment ALICE am CERN in Genf wollen
Physikerinnen und Physiker den Materiezustand unmittelbar nach dem Urknall
erforschen, das sogenannte Quark-Gluon-Plasma. In den letzten Jahren wurde der
Beschleuniger noch einmal verbessert und auch das ALICE-Experiment entsprechend
ertüchtigt. Nun warten die Teams weltweit gespannt auf die ersten Ergebnisse.
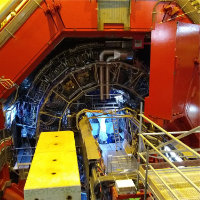
Der ALICE-Detektor am CERN in Genf wird für
das Upgrade geöffnet.
Bild: Sebastian Scheid / Goethe-Universität
Frankfurt[Großansicht] |
Wenige Sekundenbruchteile nach dem Urknall lag die gesamte Materie des
Universums in einer Art "Elementarteilchen-Suppe" als sogenanntes Quark-Gluon-Plasma
vor. Solch ein Quark-Gluon-Plasma lässt sich in Teilchenbeschleunigern für
extrem kurze Zeit erzeugen, wenn man schwere Ionen kollidieren lässt. Daher sind
die Kollisionen von Blei-Ionen von zentraler Bedeutung für das ALICE-Experiment
am Beschleunigerzentrum CERN, das die Eigenschaften von Materie, wie sie kurz
nach dem Urknall vorgelegen hat, untersuchen möchte.
Während einer vierjährigen Umbauphase von 2018 bis 2022 wurde der weltweit
stärkste Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider am CERN,
nochmals verbessert und kann jetzt deutlich mehr Bleiionen beschleunigen als
zuvor. Auch der ALICE-Detektor wurde in dieser Zeit ertüchtigt, um die höheren
Kollisionsraten, die der LHC in Zukunft liefern wird, aufzeichnen zu können.
Hierzu war es notwendig, die Auslesedetektoren des zentralen Detektors des
Experiments, der sogenannten Spurendriftkammer TPC (engl. "Time Projection
Chamber") komplett auszutauschen. Die Projektleitung dieses bislang zehnjährigen
Unterfangens liegt bei Prof. Harald Appelshäuser vom Institut für Kernphysik der
Goethe-Universität Frankfurt.
Die neue TPC soll es unter anderem ermöglichen, die Temperatur des Quark-Gluon-Plasmas
zu bestimmen, das während der der Blei-Blei-Kollision entsteht. Jetzt wurden am
CERN für das ALICE-Experiment in einem Testlauf erstmals Kollisionsenergien von
5,36 Teraelektronenvolt pro Blei-Blei-Kollision erzeugt, die weltweit höchste
bislang erreichte Kollisionsenergie. Mit den Tests können die
ALICE-Forscherinnen und -Forscher überprüfen, ob die Auslese und
Signalverarbeitung wie erwartet funktionieren. Eine große Herausforderung sind
dabei die enormen Datenmengen, die während der Messungen anfallen und allein für
die TPC im Bereich von mehreren Terabyte pro Sekunde liegen.
Dieser Datenstrom muss in Echtzeit mit effektiven Mustererkennungsmethoden
prozessiert werden, um die gespeicherte Menge der Daten ausreichend reduzieren
zu können. Eigens hierzu wurde das Rechencluster EPN (Event Processing Nodes)
für das Experiment aufgebaut. Das EPN-Cluster basiert sowohl auf konventionellen
Prozessoren (CPUs) als auch auf speziellen Grafikprozessoren. Die Leitung dieses
Projekts liegt bei Prof. Volker Lindenstruth, Frankfurt Institute for Advanced
Studies (FIAS) und Institut für Informatik der Goethe-Universität. Die ersten
Messungen bei der neuen Energie sind ein großer Erfolg für das
Schwerionenprogram am CERN. "Wir können es kaum erwarten, dass es nun wirklich
losgeht mit den Messungen", so Appelshäuser.
|

