|
Wie findet man Leben im All?
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung der Universtät Bern
astronews.com
29. Juni 2018
Im kommenden Jahrzehnt sollten die dann verfügbaren
Teleskope erstmals eine detaillierte Analyse der Atmosphären von extrasolaren
Planeten und die Suche nach sogenannten Biosignaturen erlauben. Auf diesen
Zeitpunkt wollen Astrobiologen vorbereitet sein und arbeiten in einem
internationalen Netzwerk an neuen Verfahren, mit denen sich Leben auf fernen
Welten nachweisen lassen könnte.
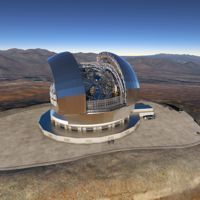
Eine Hoffnung der Exobiologen: Das
Extremely Large Telescope der ESO, das ab dem
kommenden Jahrzehnt ganz neue Daten über
extrasolare Planeten liefern wird.
Bild: ESO / L. Calçada/Ace Consortium [Großansicht] |
Vor drei Jahren hat die NASA ein Netzwerk von Forschenden aus aller Welt
gegründet. Es soll Technologien vorantreiben und helfen, die folgende Frage zu
klären: Sind wir allein im Universum? Russell Deitrick und Daniel Angerhausen
von der Universität Bern sind Teil dieser internationalen Gruppe, die nun eine
umfassende Reihe von Arbeiten zur Suche nach Spuren von Leben auf Planeten
außerhalb unseres Sonnensystems vorgelegt hat.
Da wir derzeit nicht zu Exoplaneten reisen können, müssen die Wissenschaftler
sie mithilfe von Teleskopen aus der Ferne auf sogenannte Biosignaturen
untersuchen. "Leben zu erkennen ist eine große Herausforderung", sagt Deitrick.
"Fast jeden Tag wechsle ich meine Haltung von hoffnungsvoll zu zynisch und
wieder zurück." Er glaubt, dass man sich in den nächsten zehn Jahren vor allem
darauf konzentrieren wird, die Exoplaneten im Allgemeinen und das Lebens auf der
Erde besser zu verstehen. "Wahrscheinlich werden wir im darauffolgenden
Jahrzehnt die Teleskope und neuen Technologien erhalten, die wirklich eine
Chance haben, potenzielle Biosignaturen zu erkennen", fasst er zusammen.
"Wenn Leute fragen, was mein größter Traum ist, sage ich immer, dass ich Teil
des Teams sein will, das Leben im Weltraum findet. Diese Arbeiten sind ein
großer Schritt in jene Richtung und zeigen den Weg, den wir gehen werden", so
Angerhausen. In ihrer Studie zeigen die Astrophysiker, wie sich die
Forschung entwickeln wird – von den aktuellen Abschätzungen der Größe und
Umlaufbahnen dieser fernen Welten zu einer gründlichen Analyse ihrer chemischen
Zusammensetzung und schließlich zur Frage, ob sie Leben beherbergen.
Das James-Webb-Weltraumteleskop, das nun 2021 starten soll, und
Bodenteleskope der 30-Meter-Klasse Anfang der 2020er Jahre werden systematische
chemische Untersuchungen von potenziell bewohnbaren Planeten ermöglichen, die um
kühlere Sterne kreisen. Um solche Ziele bei sonnenähnlichen Sterne zu
untersuchen, braucht es jedoch wahrscheinlich eine spezielle Weltraummission,
die Bilder liefern kann. Die erste, derartige Möglichkeit ist WFIRST (Wide Field
Infrared Survey Telescope), ein Teleskop, das Mitte der 2020er Jahre gestartet
werden soll.
Das Team geht davon aus, dass der Nachweis von Signaturen in der Atmosphäre
einiger potenziell bewohnbarer Planeten möglicherweise vor 2030 erfolgen wird.
Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer detaillierteren,
systematischen Erhebung nach 2030. Aber Deitrick warnt: "Was wir entdecken, wird
keineswegs eindeutig sein. Daher ist der Nachweis einer Biosignatur wohl bloß
der Anfang auf der Suche nach Leben. Danach folgt das Überprüfen und Verstehen –
deshalb geben wir uns heute so viel Mühe mit dieser Arbeit."
Tatsächlich diskutieren die Forscher in einem der jetzt veröffentlichten
Artikel, wie die Natur sie austricksen könnte, indem sie Lebenszeichen auf einem
Planeten finden, wo es keine Lebewesen gibt und umgekehrt. Die Autoren
untersuchen, wie ein Planet Sauerstoff ohne Lebewesen herstellen kann und wie
Planeten mit Leben andere Spuren aufweisen könnten als Sauerstoff, der auf der
heutigen Erde reichlich vorhanden ist.
Das vom Astrobiologie-Programm der NASA gegründete internationale Netzwerk
heißt "Nexus for Exoplanet System Science", kurz NExSS. Dieser Gruppe
anzugehören, ist für die Astrophysiker in Bern ein besonderes Erlebnis. "Dieses
Unterfangen bringt so viele Disziplinen zusammen", sagt Deitrick: "Es fordert
einen wirklich heraus, anders zu denken." Und Angerhausen fügt hinzu: "Ich bin
stolz und glücklich, ein kleines Zahnrad in dieser erstaunlichen und
vielfältigen Gemeinschaft zu sein."
Die neuen Studien sind in mehreren Fachartikeln in der Zeitschrift
Astrobiology erschienen.
|

