|
Wie ein Stern erwachsen wird
von Stefan Deiters
astronews.com
30. Januar 2008
Mit dem Interferometer des Very Large Telescopes
der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile haben Astronomen nun den inneren
Teil einer Gas- und Staubscheibe untersucht, die um einen sehr jungen Stern
kreist. Durch ihre Beobachtungen konnten sie verfolgen, wie die gerade
entstandene Sonne Material aus der Scheibe aufnimmt und so langsam zu einem
richtigen Stern heranwächst.
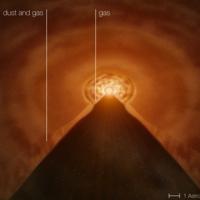
Künstlerische Darstellung der Staubscheibe um
MWC 147.
Bild: ESO [Großansicht] |
Das Objekt, das die Astronomen untersuchten, trägt den Namen MWC
147 und liegt in rund 2.600 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Einhorn. MWC 147
gehört zur Familie der sogenannten Herbig Ae/Be-Objekte und hat zur Zeit die
etwa fünffache Masse unserer Sonne. MWC 147 wächst aber zur Zeit noch: Der junge
Stern nimmt Material aus der ihn umgebenden Scheibe aus Gas- und Staub auf
und vergrößert dadurch seinen Masse kontinuierlich. Bei Herbig Ae/Be-Sternen
handelt es sich um Sterne, die noch nicht ausgewachsen sind und zudem einem
bestimmten Spektraltyp angehören. Sie sind nach dem
amerikanischen Astronomen George Herbig benannt, der sie erstmals vor etwas mehr
als 40 Jahren klassifizierte.
MWC 147 ist weniger als eine halbe Millionen Jahre alt und damit ein
wirkliches stellares Baby. Zum Vergleich: Unsere Sonne hat ein Alter von 4,6
Milliarden Jahren, Sterne im erwarteten Massenbereich von MWC 147 werden
allerdings nur rund 35 Millionen Jahre alt. Für die Astronomen ist die
Untersuchung der Vorgänge um einen so jungen Stern interessant, weil sie hoffen,
durch die detaillierten Beobachtungen mehr über die Abläufe bei der
Sternentstehung zu erfahren - und auch darüber, wie in der den Stern umgebenden
Scheibe vielleicht einmal Planeten entstehen können.
Die Astronomen Stefan Kraus vom Bonner Max-Planck-Institut für
Radioastronomie und seine Kollegen Thomas Preibisch und Keiichi Ohnaka haben MWC
147 nun mit den großen 8,2 Meter Teleskopeinheiten des Very Large Telescope
der ESO in Chile untersucht und für ihre Beobachtungen zwei beziehungsweise drei
der Teleskope zusammengeschaltet. Die Kombination des Lichts mehrerer Teleskope
für eine Beobachtung wird als Interferometrie bezeichnet.
"Für unsere Beobachtungen von MWC 147 haben wir erstmals interferometrische
Daten aus dem nahen und mittleren Infrarot-Bereich bei einem Hebrig Ae/Be-Stern
kombiniert und konnten so die Größe der Scheibe des Objekts in einem großen
Wellenlängenbereich vermessen", erläutert Kraus, der auch Hauptautor eines
Fachartikels ist, der in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal
erscheinen wird. "Unterschiedliche Wellenlängenbereiche messen unterschiedliche
Temperaturen, so dass wir die Geometrie der Scheibe vermessen und die
Temperaturentwicklung mit der Entfernung zum Stern verfolgen konnten."
Die Beobachtungen der Astronomen zeigten, dass die Temperatur mit zunehmender
Entfernung vom Stern deutlich stärker abfällt als es die Modelle vorhersagen,
was nach Ansicht der Forscher darauf hindeutet, dass der größte Teil des Lichts
im nahen Infrarot aus unmittelbarer Nähe des Sterns (also aus einer Entfernung,
die maximal dem ein- bis zweifachen Abstand der Erde von der Sonne entspricht)
zu kommen scheint. Das bedeutet aber auch, dass es in dieser Region keinen Staub
geben kann, da es dafür einfach zu heiß ist.
"Wir haben nummerische Simulationen durchgeführt, um die Beobachtungen zu
verstehen", erläutert Kraus. "Wir glauben, dass wir nicht nur die äußere
Staubscheibe beobachtet, sondern auch starke Emissionen von der heißen inneren
Gasscheibe gesehen haben. Das bedeutet, dass die Scheibe nicht passiv ist, das
heißt nicht nur einfach Licht
von dem Stern wieder abstrahlt. Stattdessen sehen wir vermutlich Material
welches aus den äußeren Bereichen der Scheibe zum gerade entstehenden Stern
transportiert wird."
Nach dem Modell, das am besten mit den Daten übereinstimmt, verfügt MWC 147
über eine Scheibe, die bis in eine Entfernung von 100 Astronomischen Einheiten,
also der 100-fachen Entfernung der Erde von der Sonne, reicht. Der Stern im
Zentrum der Scheibe wächst nach diesem Modell jedes Jahr um den
siebenmillionsten Teil der Masse unserer Sonne.
|

