|
Nur
die Schnellsten kommen durch
von Stefan
Deiters
astronews.com
27. April 2001
Die Geburt von Planeten ist eine gefährliche Sache: Neue
Bilder des Hubble-Weltraumteleskops deuten darauf hin, dass die
Entstehung eines Planeten aus Unmengen von Gas und Staub ein Wettlauf
gegen die Zeit ist. Gelingt es der entstehenden Welt nicht schnell genug
zu wachsen, kann sie von der intensiven Strahlung im
Sternentstehungsgebiet wieder zerstört werden. Die Erkenntnisse könnten
helfen, die Zahl der Planeten in unserer Milchstraße genauer
abzuschätzen.
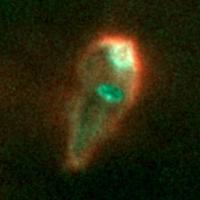
Hubble-Aufnahme
einer protoplanetaren Scheibe im Orion-Nebel. Foto: NASA,
J. Bally (Univ. v. Colorado, Boulder), H. Throop (SWRI, Boulder),
C.R. O'Dell (Vanderbilt University, Nashville) |
| Weitere
Bilder |
"Das ist das erste
Mal, dass wir die langsam größer werdenden Staubkörner im sichtbaren Bereich
des Lichtes in diesen protoplanetaren Scheiben beobachten konnten", freut
sich Henry Throop, vom Southwest Research Institute in Boulder, der
zusammen mit seinem Kollegen John Bally von der Universität in Colorado mit dem
Hubble-Weltraumteleskop untersucht hat, ob im Orion-Nebel gerade
Planeten heranwachsen. "Die Körner des Staubs, den wir hier sehen, sind
groß und ganz anders als die, die wir in anderen Sternentstehungsgebieten
beobachten können. Wir sehen hier wirklich die erste Phase von
Planetenentstehung." So zeigen die Hubble-Bilder
erstmals, dass es recht leicht passieren kann, dass in der Staubscheibe um eine
neuentstandene Sonne Planetenentstehung einsetzt. Nach der bisherigen Theorie
verklumpen dabei kleinste Staubteilchen zu immer größeren Partikeln, die
schließlich durch ihre Anziehungskraft immer mehr Materie ansammeln bis sie
schließlich zu Proto-Planeten werden.
So stellt man sich auch die Entstehung
unseres Sonnensystems vor. Doch die Bilder des Weltraumteleskops machen auch
deutlich, dass es beträchtliche Gefahren auf dem Weg zum Planeten gibt:
"Da passieren zwei Dinge in diesen Systemen", erläutert Throop.
"Staubteilchen fangen an zu verklumpen als erster Schritt auf dem Weg zum
Planeten, aber gleichzeitig gibt es eine intensive Strahlung von den hellen
Sternen in der Region, die alles wegfegt. Das ist im Prinzip so, als wollte man
mitten in einem Tornado einen Wolkenkratzer bauen. Schwer zu sagen, wer da
gewinnt."
Wenn die Planeten
nicht in der Lage wären, sich schnell genug zu bilden, könnte dies bedeuten,
dass es deutlich weniger von ihnen gibt als bislang angenommen. Dies stünde, so
die Astronomen, allerdings nicht im Widerspruch zu den bisherigen Planetenfunden
um andere Sonnen, aus denen man folgern kann, dass etwa fünf Prozent aller
Sterne über Jupiter-ähnliche Planeten verfügen.
Diese protoplanetaren
Scheiben, die einen Durchmesser haben, der größer ist als unser Sonnensystem,
wurden erstmals 1992 im Orion-Nebel entdeckt und galten lange Zeit als
hervorragende Bestätigung der gängigen Planetenentstehungs-Theorien. Weitere
Beobachtungen machten dann aber auch den zerstörerischen Einfluss der Strahlung
von jungen und hellen Sternen deutlich, die die Gas- und Staubkörner einfach
wegblasen können. Im Falle dieser Aufnahmen stammt die Strahlung vom heißesten
Stern des Nebels Theta 1 Orionis C. Der Orion-Nebel liegt ungefähr 1.500
Lichtjahre von uns entfernt und ist das der Erde am nächsten gelegene
Sternentstehungsgebiet.
Die Forscher
schätzen, dass innerhalb der nächsten 100.000 Jahre die meisten dieser jungen
Staubscheiben durch die Strahlung zerstört sein werden. Nur in einigen wenigen
werden sich vermutlich auf die bekannte Weise Planeten bilden können. "Wir
sehen hier deutlich, dass Planetenbildung eine gefährliche Sache ist", so
Bally. Der Staub aus der Scheibe dürfte mit der Zeit verschwinden und aus den
ersten kleinerer festen Brocken könnten dann erdähnliche Planeten
werden.
|

