|
Geburt eines Riesenplaneten beobachtet?
von Stefan Deiters
astronews.com
28. Februar 2013
Astronomen könnten mit dem Very Large Telescope der
europäischen Südsternwarte ESO einen sich gerade bildenden Gasplaneten in der
Staubscheibe um eine junge Sonne direkt beobachtet haben. Bestätigt sich der
Fund, würden sich anhand des Objekts aktuelle Theorien über die Entstehung von
Planeten überprüfen lassen.

So könnte der
gerade entstehende Planet um HD 100546 aussehen. Bild:
ESO/L. Calçada
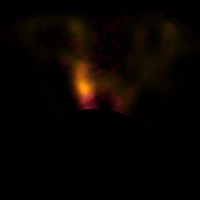
Beobachtungen im
nahen Infrarot zeigen ein helles Objekt in der
Staubscheibe um HD 100546. Der Stern wurde durch
eine Blende (unten) verdeckt und sein Licht
herausgefiltert. Bild:
ESO |
Einem internationalen Astronomenteam um Sascha Quanz vom Institut für
Astronomie der ETH Zürich in der Schweiz könnte eine bislang einmalige
Entdeckung gelungen sein. In der Staubscheibe um den jungen Stern HD 100546 in
einer Entfernung von 335 Lichtjahren spürten die Wissenschaftler ein Objekt auf,
bei dem es sich vermutlich um einen gerade entstehenden Planeten handelt. Später
dürfte aus diesem Protoplaneten einmal ein Gasriese wie der Jupiter werden.
"Bislang war die Entstehung von Planeten in der Regel etwas für
Computersimulationen", so Quanz. "Wenn es sich bei unserer Entdeckung
tatsächlich um einen Planeten handelt, der gerade entsteht, könnten
Wissenschaftler erstmals den Prozess der Planetenentstehung direkt untersuchen
und auch die Wechselwirkungen eines entstehenden Planeten mit dem Material in
seiner Umgebung."
HD 100546 ist ein relativ gründlich untersuchter Stern im Sternbild Fliege.
Die nur wenige Millionen Jahre alte Sonne ist, wie viele junge Sterne, von einer
Staubscheibe umgeben. In dieser können sich - so die aktuellen Vorstellungen der
Astronomen - Planeten bilden. Die Scheibe von HD 100546 ist mit einem
Durchmesser von etwa 700 Astronomischen Einheiten außergewöhnlich groß und
deshalb sehr gut mit Teleskopen zu beobachten. Eine Astronomische Einheit
entspricht der mittleren Entfernung der Erde von Sonne, also rund 150 Millionen
Kilometern.
In einer Entfernung von etwa sechs Astronomischen Einheiten um HD 100546
haben Astronomen bereits vor rund zehn Jahren einen Planeten entdeckt, der sich
durch eine Lücke in der Staubscheibe verraten hat (astronews.com
berichtete). Jetzt hat das Team um Quanz die Staubscheibe um HD 100546 mit
dem Very Large Telescope erneut unter die Lupe genommen und ist, dank
eines speziellen Beobachtungs- und Datenanalyseverfahrens, auf eine Punktquelle
in einem Abstand von etwa 70 Astronomischen Einheiten gestoßen. Könnte es sich
um einen weiteren Planeten handeln?
Als die Forscher die Masse dieser Quelle mithilfe von Modellen berechneten,
stießen sie allerdings auf ein Problem: "Die berechnete Masse des Planeten würde
ungefähr 20-mal der Masse des Jupiters entsprechen", so Quanz. Ein so
massereicher Planet hätte in der Scheibe um HD 100546 für deutlich sichtbare
Lücken sorgen müssen, die man allerdings nicht entdeckt hat.
Nach Ansicht der Astronomen gibt es für das Objekt zwei mögliche Erklärungen:
Es könnte sich um einen sehr jungen Planeten handeln, der noch immer Material
aufnimmt und auf diese Weise weiter wächst. Dadurch wäre er heller und heißer
und würde nur wie ein massereicher Planet strahlen ohne aber tatsächlich schon
einer zu sein. Die Forscher glauben, dass sie es hier mit einem Protoplaneten zu
tun haben könnten, der gerade einmal wenige 100.000 Jahre alt ist.
"Es gibt Modelle, die vorhersagen, wie sich die Helligkeit eines
Protoplaneten entwickelt. Unsere Beobachtungen stimmen sehr gut mit diesen
Modellen überein, was ein wichtiges Indiz für die Richtigkeit dieser These ist",
so Quanz. Die Entdeckung eines solchen Protoplaneten wäre, so die
Wissenschaftler, eine Sensation. Zum ersten Mal könnte man nämlich dann die
Entstehung eines Planeten beobachten und die schon seit längerer Zeit
existierenden Theorien und Modelle endlich an einem konkreten Objekt überprüfen.
Es gibt allerdings noch ein alternatives Erklärungsmodell für die
Beobachtung, das von dem Team um Quanz jedoch als weniger wahrscheinlich
eingestuft wird: Es könnte sich bei dem Objekt um einen Planeten handeln, der
aus dem Inneren der Scheibe stammt und von dort, etwa durch Wechselwirkung mit
dem in dieser Region vermuteten Planeten, herausgeschleudert wurde. "Wir hätten
einen Planeten in dem Moment entdeckt, in dem er vom Stern wegdriftet. Das wäre
ein sehr großer Zufall", gibt Teammitglied Michael Meyer zu bedenken, der
Professor am Institut für Astronomie der ETH Zürich ist.
Glücklicherweise sollte sich auf recht einfache Weise feststellen lassen,
welches Erklärungsmodell stimmt. Man benötigt nur weitere Beobachtungen. Bewegt
sich das Objekt im Laufe des nächsten Jahrzehnts radial vom Stern weg, dürfte es
sich um einen hinausgeschleuderten Planeten handeln. Folgt das Objekt hingegen
einer Umlaufbahn um den Stern, sollte es sich tatsächlich um einen Protoplaneten
handeln. In einem Jahr würde sich ungefähr ein Grad Abweichung vom heutigen
Standort ergeben. "Wenn wir das Objekt regelmäßig beobachten, werden wir schon
bald nachweisen können, welche These richtig ist", gibt sich Quanz
zuversichtlich.
Die Astronomen wollen schon im April die Staubscheibe um HD 100546 erneut
anvisieren. Über ihre aktuellen Resultate berichten sie heute in der
Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters.
|

