|
Künstlicher Stern schafft klaren Blick
von Stefan Deiters
astronews.com
13. Juni 2007
Um die Störungen durch die Unruhe in der Atmosphäre bei
erdgebundenen astronomischen Beobachtungen auszugleichen, verwenden große
Teleskope seit einiger Zeit eine sogenannte adaptive Optik. Dazu wird allerdings
ein relativ heller Referenzstern in der Nähe des Zielobjekts benötigt, der aber
nicht immer vorhanden ist. Deswegen machen sich die Astronomen am Very Large
Telescope der ESO den Referenzstern künftig selbst: mit einem
starken Laser.

Die wechselwirkenden Galaxien IRAS 09061-1248
aufgenommen mit dem neuen Laser Guide System für
die adaptive Optik (oben). Unten eine Aufnahme
mit einem Teleskop, das ohne adaptive Optik
auskommen musste (aus dem UKIRT-Archiv). Bilder:
ESO [Großansicht]
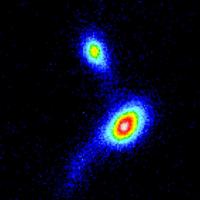 |
Die Teleskope werden immer größer, doch einem Faktor, der die
Bildqualität entscheidend beeinflusst, können sie auf der Erde nicht entgehen:
der Unruhe der Erdatmosphäre. Zwar befinden sich die großen Observatorien schon
an abgelegenen Orten und in großer Höhe, doch reicht auch dort die Luftunruhe aus, um die
Beobachtungen empfindlich zu stören. Als Ausweg bietet sich hier die sogenannte
adaptive Optik an, bei der die Störungen der Atmosphäre mit Hilfe verstellbarer Spiegel und
ausgefeilter Computerprogramme ausgeglichen werden.
Damit dieses Verfahren allerdings funktioniert, benötigt das System einen
Referenzstern in der Nähe des beobachteten Objektes. Dieser ist leider nicht
immer vorhanden, weswegen man sich am Very Large Telescope der
Europäischen Südsternwarte (ESO) auf dem Paranal in Chile eine Ersatzlösung ausgedacht
hat: Man erzeugt mit einem starken Laser einen künstlichen Stern in der
Atmosphäre (astronews.com berichtete).
Inzwischen sind zwei der wissenschaftlichen Geräte, die eine adaptive Optik
benutzen, mit dem sogenannten Laser Guide Star-System ausgerüstet: Die
Infrarotkamera und der Spektrograph NACO sowie der Spectrograph for Integral
Field Observation in the Near-Infrared (SINFONI). Beide Geräte haben jetzt
unter Verwendung des neuen Systems erste wissenschaftliche Ergebnisse geliefert
und damit gezeigt, dass das Konzept eines künstlichen Referenzsterns eine Zukunft
hat. "Die einmaligen Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll die Vorteile der
Nutzung des Laser Guide Stars mit der adaptiven Optik, da sie mit einem
natürlichen Referenzstern gar nicht hätten gemacht werden können", meint auch
Norbert Hubin, der die Adaptive-Optik-Gruppe der ESO leitet. "Das ist ein
wichtiger Meilenstein für zukünftige Entwicklungen beim Very Large Telescope
oder dem geplanten European Extremly Large Telescope."
"Um das Laser Guide Star-System bis an seine Grenzen zu testen haben wir
zahlreiche Galaxien beobachtet - von einer Nachbargalaxie bis hin zu Galaxien im
jungen Universum", erläutert Markus Kasper von der ESO. Und das neue System
enttäuschte nicht: Zu den ersten beobachteten Objekten zählten wechselwirkende
Galaxien, deren Bilder so detailreich waren, dass sie sich durchaus mit
Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble messen können. In einem Fall war es
sogar möglich, die Bewegung der Sterne in zwei verschmelzenden Galaxien zu
bestimmen und nachzuweisen, dass es in dem System zwei rotierende Scheiben aus
Sternen geben muss, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen.
Auch Beobachtungen von fernen Galaxien mit dem künstlichen Referenzstern
überzeugten die Astronomen: "Die Beobachtungen sind schon bemerkenswert und auch
aufregend, zeigen sie doch zum ersten Mal detailliert die Verteilung von Sternen
und Gas in einer weit entfernten Galaxie und damit in einer Zeit, in der wir die Entstehung von
Galaxien verfolgen können, die unserer Milchstraße gleichen," so Kasper. Ähnlich
eindrucksvolle Aufnahmen konnten die Astronomen auch von aktiven Galaxien machen.
Doch selbst zur Beobachtung von viel näher gelegenen Objekten kann das neue
Laser Guide Star-System eingesetzt werden: So sind etwa Beobachtungen von
bestimmten Regionen der Riesenplaneten oder das Studium von
Trans-Neptun-Objekten oder Asteroiden denkbar. Das VLT Laser Guide System
wurde von der ESO zusammen mit den Max-Planck-Instituten für
extraterrestrische Physik in Garching und für Astronomie in Heidelberg
entwickelt.
|

